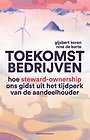Organisationales Lernen
Wettbewerbsvorteil der Zukunft
Samenvatting
Unter den Konzepten und Begriffen, welche die gegenwartigen Diskussion in der Managementiehre pragen, hat sich das organisationaie Lemen in jungster Zeit beharrlich seinen Weg gebahnt. Auch wenn das Etikett eines "Modebegriffes" abwertend erscheinen mag, laBt sich nicht ubrsehen, daB sowohl Theoretiker als auch Praktiker Fragen des Lernens verstarkte Aufmerksamkeit widmen. Einer der dominierenden Aus16ser hierfUr ist der wachsende Veranderungsdruck, dem sich die Unternehmen im ausgehenden 20. Jahrhundert ausgesetzt sehen. Die sHindig steigende Geschwindigkeit des Wandels und die daraus resultierende Not wendigkeit, sich in einer immer komplexer werden den Umwelt zu orientieren, mach en Lernen zu einer absoluten Prioritat. Unternehmen, die sich mit den Aspekten des organisationalen Wandels sowie der Erarbeitung und Forderung ihrer Entwick lungsfahigkeit nicht erfolgreich auseinandersetzen, riskieren, auf absehbare Zeit zu den Verlierern zu gehoren. Arie de Geus (1988) geht sogar so we it zu behaupten, daB Lernen den einzig uberdauernden Wettbewerbsvorteil der Zukunft darstellt. In Anbetracht der groBen Aufmerksamkeit, die das organisationaie Lemen geweckt hat, ist es ein Grund zur Beunruhigung, daB die Definition und Verwendung des Begriffes durch beachtliche Konfusion gekennzeichnet ist. Dabei ist es intuitiv ohne weiteres zu verstehen, daB Organisationen lernfahig sein sollten, urn ihre Wettbe werbsfahigkeit zu erhalten oder zu erhohen. Schwierigkeiten bereitet allerdings das konkrete Verstandnis des Begriffs organisationaies Lemen vor allem in seiner Abgrenzung zu individuellen Lernprozessen. Die Gleichsetzung der beiden ist dabei vollig unzulassig. Dies ware nicht der erste miBlungene Versuch, von einem indivi duellen Phanomen auf die Eigenschaften eines gr6Beren Ganzen zu schlieBen.
Specificaties
Inhoudsopgave
Anderen die dit kochten, kochten ook
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht