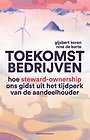1 Grundlagen.- 1.1 Einführung.- 1.1.1 Die drei zentralen Fragestellungen der Geldpolitik.- 1.1.2 Überblick.- 1.1.3 Ergänzende Literaturhinweise.- 1.2 Spielt Geldpolitik überhaupt eine Rolle?.- 1.3 Die Aufgaben der Geldpolitik.- 1.3.1 Sicherung der Preisstabilität.- 1.3.2 Stabilisierung von Konjunkturschwankungen.- 1.4 Die Kosten der Inflation.- 1.4.1 Die Konsequenzen nichtantizipierter Inflation.- 1.4.2 Die Konsequenzen antizipierter Inflation.- 1.4.2.1 Die Opportunitätskosten der Geldhaltung.- 1.4.2.2 Verzerrung durch Steuerprogression.- 1.4.3 Preisanpassungskosten.- 2 Geldpolitik Im Langfristigen Gleichgewicht: Preisstabilität.- 2.1 Einführung: Inflation in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion.- 2.2 Der Zusammenhang zwischen Geldschöpfung, Wachstum und Inflation.- 2.2.1 Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht bei flexiblen Preisen.- 2.2.2 Die Ineffizienz des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.- 2.2.3 Gleichgewicht auf dem Geldmarkt: Die Quantitätstheorie.- 2.2.4 Geldmengenwachstum und Inflation.- 2.2.4.1 Die Quantitätstheorie in einerwachsenden Wirtschaft.- 2.2.4.2 Zinsabhängige Geldnachfrage.- 2.2.4.3 Superneutralität des Geldes.- 2.3 Die optimale Inflationsrate.- 2.3.1 Seigniorageeinnahmen und Geldschöpfung.- 2.3.1.1 Die intertemporale Budgetrestriktion des Staates.- 2.3.1.2 Seignioragekonzepte.- 2.3.2 Die optimale Inflationsrate nach Friedman.- 2.3.3 Maximierung der Geldschöpfungseinnahmen.- 2.3.4 Minimierung der Wohlfahrtsverluste aus Besteuerung.- 2.3.5 Inflation als Schmiermittel der Wirtschaft?.- 2.4 Probleme bei der Inflationskontrolle.- 2.5 Übungsaufgaben.- 3 Geldpolitik Bei Kurzfristigen Störungen: Stabilisierungspolitik.- 3.1 Kurz- und langfristige Phillipskurve.- 3.1.1 Die kurzfristige Phillipskurve.- 3.1.2 Geldpolitik bei adaptiven Erwartungen.- 3.1.3 Geldpolitik bei rationalen Erwartungen.- 3.1.3.1 Langfristiges Gleichgewicht.- 3.1.3.2 Geldpolitik angesichts von Schocks.- 3.1.3.3 Reaktion auf Nachfrageschocks.- 3.1.3.4 Reaktion auf Angebotsschocks.- 3.1.3.5 Formale Analyse.- 3.1.4 Ableitung der aggregierten Angebotskurve bei einer Cobb/Douglas-Produktionsfunktion.- 3.2 Geldpolitik bei monopolistischer Konkurrenz.- 3.2.1 Die Natur von Nachfrageexternalitäten.- 3.2.2 Der Menükostenansatz.- 3.3 Übungsaufgabe.- 4 Geldpolitik Als Kontrollproblem.- 4.1 Wohlfahrtsanalyse der Stabilisierungspolitik.- 4.1.1 Optimale flexible Politik.- 4.1.2 Die Äquivalenz unterschiedlicher Regeln bei perfekter Information.- 4.1.3 Ein Vergleich verschiedener starrer Regeln.- 4.1.3.1 Geldmengenregel.- 4.1.3.2 Inflationsziel (Inflation Targeting).- 4.1.3.3 Outputziel.- 4.1.3.4 Nominales BIP-Ziel.- 4.2 Geldpolitik bei stochastischen Kontrollfehlern.- 4.2.1 Das Grundproblem.- 4.2.2 Preisziel vs. Inflationsziel.- 4.2.3 Indikatoren und Zwischenziele.- 4.2.3.1 Indikatoren und Reaktionsfunktionen.- 4.2.3.2 Zwischenziele.- 4.2.3.3 Inflation Targeting: Endziel oder Zwischenziel?.- 4.2.4 Instrumente der Geldpolitik: Zins- vs. Geldmengensteuerung.- 4.3 Transmissionsmechanismen der Geldpolitik.- 4.3.1 Der Zinskanal.- 4.3.2 Der Wechselkurskanal.- 4.3.3 Der Kreditkanal.- 4.3.4 Der Kanal der relativen Preise (Monetarismus).- 5 Das Problem Der Glaubwürdigkeit von Geldpolitik.- 5.1 Das Barro Gordon Modell.- 5.1.1 Commitment-Lösung.- 5.1.2 Die diskretionäre Lösung.- 5.1.3 Modellbeispiel: Quadratische Verlustfunktion.- 5.1.3.1 Commitment-Lösung.- 5.1.3.2 Inkonsistenz der Commitmentlösung.- 5.1.3.3 Das diskretionäre Gleichgewicht.- 5.1.4 Indexierung als Schwungrad der Inflation?.- 5.2 Reputation bei wiederholten Spielen.- 5.3 Optimale Politik bei Schocks am Beispiel der Phillipskurve.- 5.3.1 Das Grundproblem.- 5.3.2 Modellbeispiel: Quadratische Verlustfunktion.- 5.3.2.1 Die Commitment-Lösung.- 5.3.2.2 Die diskretionäre Lösung.- 5.4 Optimale Politik bei stochastischen Schocks: Ein allgemeiner Ansatz.- 5.4.1 Grundmodell.- 5.4.2 Commitment-Lösung.- 5.4.3 Diskretionäre Lösung.- 5.5 Übungsaufgaben.- 6 Flexibilität Versus Glaubwürdigkeit.- 6.1 Überblick.- 6.2 Eine starre Regel à la Friedman.- 6.2.1 Die Grundidee.- 6.2.2 Modellbeispiel.- 6.3 Wechselkursfixierung mit Austrittsklausel.- 6.3.1 Das Grundmodell.- 6.3.2 Modellbeispiel.- 6.3.3 Spekulative Abwertungen.- 6.3.4 Modellbeispiel.- 6.4 Delegation der Geldpolitik an einen konservativen Zentralbankchef.- 6.4.1 Die Grundidee.- 6.4.2 Modellbeispiel.- 6.5 Kombination von konservativem Zentralbanker und Austrittsklausel.- 6.6 Der optimale Zentralbankkontrakt.- 6.6.1 Modellanalyse.- 6.6.2 Inflation Targeting und optimaler Zentralbankkontrakt.- 6.6.3 Geldmengen- vs Inflationsziel.- 6.6.4 Unvollständige Kontrakte.- 6.6.4.1 Der zustandsabhängige Zentralbankkontrakt.- 6.6.4.2 Der konstitutionelle Weg.- 6.6.4.3 Vertragsgestaltung durch eine am Eigeninteresse orientierte Regierung.- 6.7 Endogener Verlauf der kurzfristigen Angebotskurve.- 6.8 Übungsaufgaben.- 7 Geldpolitik Als Signal Bei Asymmetrischer Information.- 7.1 Einführung.- 7.2 Grundmodell.- 7.2.1 Das Peso-Problem.- 7.2.2 Reputation und Wahrscheinlichkeitseinschätzungen.- 7.2.3 Indifferenzkurven der Zentralbanken.- 7.2.4 Die Anreizverträglichkeitsbedingung.- 7.2.5 Das Poolinggleichgewicht.- 7.2.6 Das Trenngleichgewicht.- 7.2.7 Robustheit des Informationsproblems: Korrelierte Präferenzschocks.- 7.3 Modellvariationen.- 7.3.1 Ein Semi-Pooling Gleichgewicht mit interessanten Eigenschaften (Barro).- 7.3.2 Unvollständige Information über die Commitment-Fähigkeit (Cukierman).- 8 Geldpolitik aus Politökonomischer Perspektive.- 8.1 Einführung.- 8.2 Die opportunistische Schule.- 8.2.1 Der politische Konjunkturzyklus von Nordhaus.- 8.2.2 Wahlen als Kompetenztest: Das Rogoff/Sibert-Modell.- 8.3 Die ideologische Schule: Politik als Interessenvertretung.- 8.3.1 Die Partisantheorie von Hibbs.- 8.3.2 Zyklen bei rationalen Erwartungen: Das Alesina Modell.- 8.4 Übungsaufgaben.- 9 Staatsverschuldung und Geldpolitik.- 9.1 Die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung.- 9.1.1 Die Entwicklung der Schuldenquote.- 9.1.2 Solvenz bei begrenztem Zeithorizont.- 9.2 Entschuldung durch Inflation?.- 9.2.1 Das Grundmodell.- 9.2.2 Beispiel.- 9.3 Optimale Verschuldungspolitik.- 9.4 Politökonomische Analyse von Verschuldungsstrategien.- 9.4.1 Fiskalillusion.- 9.4.2 Verschuldung als strategisches Instrument.- 9.4.3 Verteilungskonflikte als Abnutzungskrieg (War of Attrition).- 9.5 Übungsaufgabe.- 10 Einführung In Spieltheoretische Konzepte.- 10.1 Ein Beispiel: Spekulative Attacken auf fixe Wechselkurse.- 10.1.1 Die Spielmatrix als Beschreibung der Spielsituation.- 10.1.2 Lösungskonzept „Gleichgewicht in dominanten Strategien“.- 10.1.3 Lösungskonzept „Nash-Gleichgewicht“.- 10.1.4 Gleichgewicht in randomisierten Strategien.- 10.1.5 Focus-Punkte und Sunspot-Gleichgewichte.- 10.2 Das Chicken-Game und die Bedeutung von Commitment — Ein Spiel zwischen Geld- und Fiskalbehörde.- 10.2.1 Die Spielsituation.- 10.2.2 Nash-Gleichgewichte des Spiels.- 10.2.3 Sequentielle Spielstruktur: Der Spielbaum.- 10.2.4 Leere Drohungen und unplausible Gleichgewichte — Das teilspielperfekte Gleichgewicht als Verfeinerung des Nash-Gleichgewichts.- 10.2.5 Institutionelle Rahmenbedingungen: Wie sollten die Spielregeln konzipiert werden?.- 10.3 Geldpolitik bei fixen Wechselkursen — Das Nash-Gleichgewicht bei stetigem Strategieraum.- 10.3.1 Spielsituation: Geldpolitik in einem Zwei-Länder-Modell.- 10.3.2 Ein System flexibler Wechselkurse.- 10.3.3 Ein fixes Wechselkursystem mit symmetrischen Interventionsverpflichtungen.- 10.3.3.1 Das Nash-Gleichgewicht bei symmetrischer Intervention.- 10.3.3.2 Die kooperative Lösung.- 10.3.3.3 Nicht-Kooperation als Gefangenendilemma.- 10.3.3.4 Externalitäten als Ursache der Ineffizienz.- 10.3.3.5 Kooperation bei wiederholten Spielen.- 10.3.4 Das Stackelberg-Gleichgewicht.- 10.3.5 Asymmetrische Interventionsregeln.- 10.4 Abstrakte Spiele mit stetigem Strategieraum.- 10.4.1 Nash-Gleichgewicht.- 10.4.2 Effizienz.- 10.4.3 Externalitäten auf der Makroebene (N ? ?).- 10.4.4 Komparative Statik.- 10.5 Übungsaufgaben.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachindex.