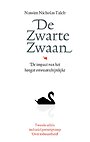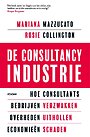A Zusammenfassung für Entscheideungsträger.- A Zusammenfassung für Entscheidungsträger.- B Einleitung: Der zivilisatorische Umbau der Biosphäre oder Die drei Säulen der Torheit.- B Einleitung: Der zivilisatorische Umbau der Biosphäre oder Die drei Säulen der Torheit.- C Die Biosphäre im Zentrum der Mensch-Umwelt-Beziehung.- C 1 Das biosphärenzentrierte Beziehungsgeflecht.- C 1.1 Die Trends des Globalen Wandels in der Biosphäre.- C 1.2 Direkte Wirkungsmechanismen innerhalb der Biosphäre.- C 1.3 Wirkungsschleifen im biosphärenzentrierten Beziehungsgeflecht des Globalen Wandels.- C 1.3.1 Gefährdung der Gen- und Artenvielfalt.- C 1.3.2 Fehlentwicklungen in Natur- und Kulturlandschaften.- C 1.3.3 Beeinträchtigung der biosphärischen Regelungsfunktionen.- C 1.3.4 Der Mensch als Bewahrer von Natur.- C 2 Die Wirkungsschleifen als Kernelemente der Syndrome.- C 2.1 Wirkungsketten als Teil eines Syndroms.- C 2.2 Wirkungsketten als Bestandteil mehrerer Syndrome.- D Genetische Vielfalt und Artenvielfalt.- D 1 Die Nutzung von Gen- und Artenvielfalt am Beispiel höherer Pflanzen.- D 1.1 Einfürhrung.- D 1.2 Grundlagen der Gen- und Artenvielfalt und deren geographische Verbreitung.- D 1.3 Nutzung der Arten durch den Menschen: Beispiel höhere Pflanzen.- D 1.3.1 Genutzte Pflanzenarten.- D 1.3.1.1 Nahrungspflanzen.- D 1.3.1.2 Medizinal- und Giftpflanzen sowie Drogen.- D 1.3.1.3 Bau-, Möbel-, Industrie- und Brennholz.- D 1.3.1.4 Faserpflanzen, Färbepflanzen, Industriepflanzen.- D 1.3.1.5 Arten zur Unterstiitzung einer „weichen“ Nachhaltigkeit.- D 1.3.1.6 Zierpflanzen.- D 1.3.1.7 Pflanzenarten in Wissenschaft und Technologie.- D 1.3.1.8 Zusammenfassung: Nutzpflanzen.- D 1.3.2 Gefährdete Pflanzenarten.- D 1.3.3 Momentan nicht genutzte Arten: Genetische Ressourcen für die Zukunft.- D 1.3.3.1 Medizinalpflanzen.- D 1.3.3.2 Nahrungspflanzen.- D 1.3.4 Schädliche Arten.- D 1.3.5 Bewertung nicht nutzbarer Arten.- D 1.4 Nutzung von Tieren und Mikroorganismen.- D 2 Ökologische Funktionen yon Arten.- D 2.1 Gene, Populationen und Arten.- D 2.2 Die Rolle von Arten innerhalb eines Ökosystems.- D 2.3 Ökosystemprozesse.- D 2.4 Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Ökosystemprozessen.- D 2.5 Ökosystemprodukte und -leistungen.- D 3 Schwerpunktthemen.- D 3.1 Der Handel mit bedrohten Arten.- D 3.1.1 Lücken und Schwachpunkte der CITES-Bestimmungen.- D 3.1.2 Konzept „Schutz durch nachhaltige Nutzung“.- D 3.1.3 Bewertung und Empfehlungen.- D 3.2 Regelungen zur biologischen Sicherheit.- D 3.2.1 Warum eine internationale Regelung für Biosafety?.- D 3.2.2 Das Biosafety-Protokoll.- D 3.2.2.1 Überblick.- D 3.2.2.2 Die weiterhin stark umstrittenen Regelungen im einzelnen.- D 3.2.2.3 Bleiben Chancen für ein Protokoll?.- D 3.2.2.4 Empfehlungen.- D 3.3 Bioprospektierung.- D 3.3.1 Einleitung.- D 3.3.2 Ökologische Grundlagen der Bioprospektierung.- D 3.3.3 Die Nutzung biologischer Vielfalt am Beispiel der Medizin.- D 3.3.3.1 Naturstoffe in der Medikamentenentwicklung.- D 3.3.3.2 Pflanzen.- D 3.3.3.3 Terrestrische Mikroorganismen.- D 3.3.3.4 Marine Mikroorganismen.- D 3.3.4 Andere Nutzungsfelder.- D 3.3.5 Zukünftige Entwicklung der Naturstoffchemie und Nutzung der biologischen Vielfalt.- D 3.3.6 Rechtliche Rahmenbedingungen und sozioökonomische Aspekte der Bioprospektierung.- D 3.4 Agrarbiodiversität: Funktion und Bedrohung im globalen Wandel.- D 3.4.1 Landwirtschaft und biologische Vielfalt — ein Widerspruch in sich?.- D 3.4.2 Funktionen und Bedeutung von Agrarbiodiversität.- D 3.4.3 Zustand der Agrarbiodiversität.- D 3.4.4 Gefährdung von Agrarbiodiversität.- D 3.4.5 Maßnahmen zur Erhaltung von Agrarbiodiversität.- D 3.4.6 Schlußfolgerungen.- D 3.4.6.1 Forschungsbedarf.- D 3.4.6.2 Handlungsbedarf.- E Vielfalt der Landschaften und Ökosysteme.- E 1 Natur- und Kulturlandschaften.- E 1.1 Räumliche und funktionale Untergliederung von Landschaften.- E 1.2 Von der Natur- zur Kulturlandschaft.- E 1.3 Anthropogene Beeinflussung der Biosphäre auf der Landschaftsebene — Fallbeispiele.- E 2 Entwicklung yon Landschaften unter menschlichem Einfluß.- E 2.1 Entwicklung der Kulturlandschaft in Mitteleuropa.- E 2.1.1 Ausgangssituation.- E 2.1.2 Einfluß des Menschen.- E 2.2 Amazonien: Revolution in einem fragilen Ökosystem.- E 2.2.1 Geologische und klimatische Ausstattung des Amazonasbeckens.- E 2.2.2 Entstehung der biologischen Vielfalt im Amazonasbecken.- E 2.2.3 Eingriffe des Menschen.- E 2.2.4 Vergleich der Eingriffe in tropische und temperate Wälder.- E 2.3 Die Einfürhrung des Nilbarsches in den Viktoriasee: Ein volkswirtschaftlicher Pyrrhussieg?.- E 2.3.1 Die Eutrophierung des Viktoriasees.- E 2.3.2 Die Artbildung der Buntbarsche als Schulbeispiel für die Evolutionstheorie.- E 2.3.3 Das Viktoriasee-Ökosystem verändert sein Gesicht.- E 2.3.4 Ist der Wandel des Viktoriasees ein Segen für die Bevölkerung?.- E 2.3.5 Verlust eines Weltnaturerbes: Zerstörung heimischer Fischpopulationen zugunsten einer nichtheimischen Art.- E 2.4 Das indonesische Flachmeer: Ökosystemzerstörung durch Übernutzung und Mißmanagement.- E 2.4.1 Korallenriffe.- E 2.4.2 Mangroven.- E 2.4.3 Fischerei.- E 2.4.4 Konfliktfeld zwischen wirtschaftlicher Nutzung sowie Biotop- und Arterhaltung.- E 2.4.5 Ausblick.- E 3 Schwerpunktthemen.- E 3.1 Wahrnehmung und Bewertung.- E 3.1.1 Einleitung.- E 3.1.2 Mensch-Natur-Schnittstellen.- E 3.1.3 Traditionale Gesellschaften („Ökosystemmenschen“).- E 3.1.4 Industrielle Gesellschaften („Biosphärenmenschen“).- E 3.1.4.1 Plurale Lebensstile und Naturwahrnehmung.- E 3.1.4.2 Auf dem Weg zu einer „biosphärischen Perspektive“.- E 3.1.5 Fazit.- E 3.2 Raum-zeitliche Trennung von Stoffumsatzprozessen in Ökosystemen.- E 3.2.1 Stoffkreisläufe in Ökosystemen.- E 3.2.2 Stoffflüsse im Boden.- E 3.2.3 Stoffflüsse in Gewässern.- E 3.2.4 Stoffflüsse in Agrarökosystemen.- E 3.2.5 Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf die Stoffflüsse.- E 3.2.6 Raum-zeitliche Trennung von Stoffumsatzprozessen in Ökosystemen: Ausblick.- E 3.3 Nachhaltige Landnutzung.- E 3.3.1 Typen der Landschaftsnutzung.- E 3.3.1.1 Die Grundidee: Die Entwicklung eines „Systems differenzierter Nutzungsintensitäten“.- E 3.3.1.2 Differenzierung zwischen verschiedenen Typen der Landschaftsnutzung.- E 3.3.2 Schutzgebiete: Schutz vor Nutzung.- E 3.3.2.1 Aufgaben und Funktionen von Schutzgebieten.- E 3.3.2.2 Artenschutz versus Ökosystemschutz?.- E 3.3.2.3 Situation von Schutzgebieten weltweit.- E 3.3.2.4 Planung und Auswahl von Schutzgebieten.- E 3.3.2.5 Effektivität und Management von Schutzgebieten.- E 3.3.2.6 Schlußfolgerungen und Empfehlungen.- E 3.3.3 „Schutz durch Nutzung“ als Strategie.- E 3.3.3.1 Das Problem: Der (vermeintliche) Konflikt zwischen Schutz und Nutzung.- E 3.3.3.2 Die Grundidee: „Schutz durch Nutzung“.- E 3.3.3.3 Übergreifende Folgerungen zur Einsetzbarkeit der Strategie.- E 3.3.3.4 „Schutz durch Nutzung“: Fallbeispiele.- E 3.3.3.5 Implementation der Strategie „Schutz durch Nutzung“.- E 3.3.3.6 Schlußbemerkung: Dezentralisierung als notwendige institutionelle Rahmenbedingung.- E 3.3.3.7 Forschungs- und Handlungsbedarf.- E 3.3.4 Schutz trotz Nutzung: nachhaltige Produktion biologischer Ressourcen.- E 3.3.4.1 Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche.- E. 3.3.4.2 Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Produktionssteigerung in unterschiedlichen Regionen.- E 3.3.4.3 Intensitätsmerkmale landwirtschaftlicher Produktion.- E. 3.3.4.4 Waldwirtschaft.- E. 3.3.4.5 Substitution von Produkten der Landnutzung.- E 3.3.4.6 Einfluß intensivierter Landnutzung auf die biologische Vielfalt.- E 3.3.4.7 Verlust von Agrarbiodiversität.- E 3.3.4.8 Agrarökosystemfunktionen und biologische Vielfalt.- E 3.3.4.9 Tierproduktion und biologische Vielfalt.- E 3.3.4.10 Multifunktionale Landnutzung.- E 3.3.4.11 Leitbild.- E 3.4 Nachhaltige Nahrungsgewinnung aus aquatischen Ökosystemen.- E 3.4.1 Hochseefischerei.- E 3.4.1.1 Wissenschaftliche Grundlagen für die Sicherstellung nutzbarer Bestände.- E 3.4.1.2 Nachhaltiges Fischereimanagement auf internationaler Ebene.- E 3.4.2 Aquakultur.- E 3.4.2.1 Integrierte Karpfenzucht als Beispiel für Süßwasserfischaquakultur.- E 3.4.2.2 Shrimp-Farming als Beispiel für die industrielle Aquakultur von Krebsen.- E 3.4.2.3 Marine Makroalgen als Beispiel für Pflanzenaquakultur.- E 3.4.2.4 Umweltfreundliches und ressourcenschonendes Aquakulturmanagement.- E 3.5 Naturschutz und Kulturschutz.- E 3.5.1 Kulturveränderung und Kulturerhalt als Erfolgsbedingung für Biosphärenpolitik.- E 3.5.2 Aneignung der Natur durch den Menschen.- E 3.5.3 Neubewertung indigener und lokaler Kulturen: Bedeutung für die Biosphärenpolitik.- E 3.5.4 Naturschutz und Kulturschutz — eine notwendige Allianz.- E 3.6 Einbringung nichtheimischer Arten.- E 3.6.1 Auftreten und Auswirkungen gebietsfremder Organismen.- E 3.6.2 Fallbeispiele.- E 3.6.3 Internationale Vereinbarungen.- E 3.6.4 Beispiele für nationale Gesetzgebungen.- E 3.6.5 Fazit für den Forschungs- und Handlungsbedarf.- E 3.7 Tourismus als Instrument für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biosphäre.- E 3.7.1 Nachhaltiger Tourismus zum Schutz der Biosphäre — eine begriffliche Eingrenzung.- E 3.7.2 Aktuelle Entwicklungstendenzen des globalen Tourismus.- E 3.7.3 Politische Initiativen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus.- E 3.7.4 Empfehlungen.- E 3.7.5 Tragfähigkeitsgrenzen für Tourismus untersuchen.- E 3.8 Die Rolle nachhaltiger Stadtentwicklung für den Biosphärenschutz.- E 3.8.1 Schlüsselrolle von Städten für eine nachhaltige Entwicklung.- E 3.8.2 Besonderheiten städtischer Ökosysteme.- E 3.8.3 Bedeutung einer hohen Biosphärenqualität für die Stadt.- E 3.8.4 Funktion von Städten für die Erhaltung der Biosphäre.- E 3.8.5 Systemzusammenhänge zwischen Biosphäre, Stadt und globaler Entwicklung.- E 3.8.6 Leitbilder und Konzepte einer nachhaltigen Stadtentwicklung.- E 3.8.7 Internationale Forschungsprogramme zur Stadtökologie.- E 3.9 Integration von Schutz und Nutzung auf regionaler Ebene.- E 3.9.1 Erfahrungen und Defizite.- E 3.9.2 Der Vorschlag des bioregionalen Managements: Prinzipien und Instrumente.- E 3.9.3 Fallbeispiele.- E 3.9.4 Bewertung und Anwendung.- E 3.9.5 Handlungsempfehlungen.- F Die Biosphäre im System Erde.- F 1 Yon Biosphäre I zu Biosphäre III.- F 1.1 Das Leben im System Erde: Biosphäre I.- F 1.2 Eine gebaute Umwelt: Biosphäre II.- F 1.2.1 Wieviel Natur braucht eine Zivilisation?.- F 1.2.2 Konstruktion eines Gleichgewichts und ihre Grenzen.- F 1.3 Ein geschärfter Blick auf Biosphäre I.- F 1.3.1 Homöostase als grundlegendes Regelungsprinzip.- F 1.3.2 Der Metabolismus des Erdsystems.- F 1.4 Auf dem Weg zur globalen Steuerung: Biosphäre III.- F 2 Globales Klima zwischen Wald und Wüste — zwei Extremszenarien.- F 2.1 Wechselwirkungen zwischen Biomen, Atmosphäre und Klima.- F 2.2 Die Biosphäre zwischen Wald und Wüste: eine Simulation.- F 2.3 Kontrolle der Biosphäre über das Klimasystem und den globalen Wasserkreislauf.- F 3 Die Biosphäre im Globalen Wandel.- F 3.1 Global wirksame zivilisatorische Eingriffe.- F 3.1.1 Direkte Eingriffe in die Biosphäre: Globale Trends.- F 3.1.2 Eingriffe in biogeochemische Kreisläufe.- F 3.2 Die terrestrische Biosphäre im Globalen Wandel.- F 3.2.1 Die terrestrische Biosphäre im Kohlenstoffkreislauf und im Klimasystem.- F 3.2.2 Szenarien für die Zukunft.- F 3.3 Die marine Biosphäre im Kohlenstoffkreislauf und im Klimasystem.- F 3.3.1 Wechselwirkungen zwischen mariner Biosphäre, Kohlenstoffkreislauf und Klimasystem.- F 3.3.2 Szenarien für die Zukunft.- F 3.4 Forschungsbedarf.- F 4 Anthropogene Klimaänderung: Folgen für Ökosysteme und Arten.- F 4.1 Reaktionen von Ökosystemen auf globale Klimaveränderungen.- F 4.2 Auswirkungen der globalen Klimaänderung auf einzelne Ökosysteme.- F 4.2.1 Wälder.- F 4.2.2 Tundraökosysteme.- F 4.2.3 Küstenökosysteme.- F 4.2.4 Korallenriffe.- F 4.3 Schlußfolgerungen.- F 5 Kritische Elemente der Biosphare im Erdsystem.- F 5.1 Rückkopplungsmechanismen.- F 5.1.1 Drastische Veränderungen als Grenzverhalten negativer Rückkopplungen.- F 5.1.2 Positive Rückkopplungen als Elemente einer kritischen Erdsystemdynamik.- F 5.2 Physiologische und metabolische Bedeutung der Biosphäre.- F 5.2.1 Amazonas-Becken.- F 5.2.2 Sahel-Region.- F 5.2.3 Boreale Wälder.- F 5.3 Biogeographische Kritikalität.- F 5.3.1 Bewertung der Bedeutung der Biosphäre für das Erdsystem.- F 5.3.2 Identifikation der für das Erdsystem wichtigen biogeographischen Regionen.- G Vernetzung von Bio- und Anthroposphäre: Das Raubbau-Syndrom.- G 1 „Raubbau“ als Syndrom des Globalen Wandels.- G 1.1 Charakterisierung.- G 1.2 Erscheinungsformen.- G 1.3 Medialer Schwerpunkt: Globale Waldökosysteme.- G 1.3.1 Die Wälder der Erde: Bestand und Gefährdung.- G 1.3.2 Einordnung des Kernproblems Entwaldung in die Syndrome.- G 2 Der Mechanismus des Raubbau-Syndroms.- G 2.1 Syndromkern.- G 2.2 Trends und Wechselwirkungen des Syndroms.- G 2.3 Mögliche Syndromverläufe.- G 2.4 Interaktion des Raubbau-Syndroms mit anderen Syndromen.- G 3 Disposition von Waldökosystemen für das Raubbau-Syndrom.- G 3.1 Dispositionsfaktoren.- G 3.2 Räumliche Verteilung der Disposition.- G 4 Intensität des Raubbau-Syndroms.- G 4.1 Bestimmung der Grundtypen des Syndroms.- G 4.2 Intensität des Raubbau-Syndroms im Hinblick auf Waldokosysteme.- G 4.2.1 Nutzung biologischer Ressourcen.- G 4.2.2 Messung des Trends Politikversagen.- G 4.2.3 Kombinierte Intensität.- G 5 Politische Implikationen der Syndromanalyse.- H Bewertung der Biosphäre aus ethischer und ökonomischer Sicht.- H 1 Die grundlegende Fragestellung.- H 2 Grundlagen der Ethik.- H 3 Grundlagen der Umweltethik.- H 4 Spezielle Prinzipien und Normen zur Nutzung der Biosphäre.- H 4.1 Die Notwendigkeit menschlicher Interventionen in die Biosphäre.- H 4.2 Die Anwendung kategorischer Prinzipien beim Biosphärenschutz.- H 4.3 Die Anwendung kompensationsfähiger Prinzipien und Normen beim Biosphärenschutz.- H 4.4 Wissen und Werte als Grundlage für Abwägungsprozesse.- H 5 Ökonomische Bewertung biosphärischer Leistungen.- H 5.1 Ökonomische Bewertung als Ausprägung einer speziellen Bewertungsethik.- H 5.2 Methodische Grundlagen und Erklärungsanspruch ökonomischer Bewertungen.- H 5.3 Überblick über die Vorgehensweise bei einer ökonomischen Bewertung der Biosphäre.- H 5.4 Wertkategorien biosphärischer Leistungen aus ükonomischer Sicht.- H 5.4.1 Einzelne Werte und ökonomischer „Gesamtwert“.- H 5.4.2 Wahrnehmung biosphärischer Werte durch den Menschen.- H 5.4.3 Die Funktion des Konzepts des ökonomischen Gesamtwertes.- H 5.5 Grenzen der Anwendbarkeit des ökonomischen Kalküls auf die Bewertung biosphärischer Leistungen.- H 5.5.1 Das Substitutionsparadigma und die Essentialität biosphärischer Leistungen.- H 5.5.2 Das Problem des Auftretens von Irreversibilitäten.- H 5.5.3 Folgerungen zur Anwendbarkeit des ökonomischen Bewertungsansatzes.- H 5.6 Versuch einer Reihung der Wertkategorien aus globaler Perspektive.- H 5.7 Fazit zur ökonomischen Bewertung.- H 6 Die Ethik der Verhandlungsführung.- H 7 Folgerungen für den Biosphärenschutz.- I Globale Biosphärenpolitik.- I 1 Leitplankenstrategie für die Bewahrung und Gestaltung der Biosphäre.- I 1.1 Erster biologischer Imperativ: Integrität der Bioregionen bewahren.- I 1.2 Zweiter biologischer Imperativ: Aktuelle biologische Ressourcen sichern.- I 1.3 Dritter biologischer Imperativ: Biopotentiale für die Zukunft erhalten.- I 1.4 Vierter biologischer Imperativ: Das globale Naturerbe bewahren.- I 1.5 Fünfter biologischer Imperativ: Regelungsfunktionen der Biosphäre erhalten.- I 1.6 Fazit: eine explizite Leitplanke für den Biosphärenschutz.- I 2 Elemente einer globalen Biosphärenpolitik.- I 2.1 Aufgabenstellung und Probleme globaler Biosphärenpolitik.- I 2.1.1 Überwindung des Wissensdefizits.- I 2.1.2 Räumliche und zeitliche Verteilungsprobleme.- I 2.1.3 Koordinationsprobleme.- I 2.1.4 Ansatzpunkte einer globalen Biosphärenpolitik.- I 2.2 Völkerrechtliche Ansätze.- I 2.2.1 Steuerungsinstrumente im nationalen Recht.- I 2.2.2 Direkte Verhaltensregelung als Steuerungsinstrument im internationalen Recht.- I 2.2.2.1 Das Fehlen von Vollzugsorganen im internationalen Umweltrecht.- I 2.2.2.2 Das Fehlen von zentralen Entscheidungsinstanzen im internationalen Umweltrecht.- I 2.2.2.3 Direkte Verhaltenssteuerung als Umsetzungsvorgabe in völkerrechtlichen Verträgen.- I 2.2.4 Mechanismen zur Gewährleistung der Vertragserfüllung.- I 2.3 Ansätze für positive Regelungen.- I 2.3.1 Negative versus positive internationale Regelungen.- I 2.3.2 Bedingungen positiver Regelungen und Anreize.- I 2.3.3 Schlußfolgerungen für Schutz und Nutzung der Biosphäre.- I 2.4 Motivierungsansätze.- I 2.5 Ansätze für Umweltbildung und Umweltlernen.- I 2.5.1 Einleitung.- I 2.5.2 Umweltbildung und der Schutz der Biosphäre.- I 2.5.3 Aufgaben von Umweltbildung und Umweltlernen.- I 2.5.4 Inhaltliche Kriterien für die Gestaltung der Bildung für den Schutz der Biosphäre.- I 2.5.5 Maßnahmen für das „Lernen“ nachhaltiger Lebensstile.- I 2.5.6 Forschungs- und Handlungsempfehlungen.- I 3 Die Biodiversitätskonvention: Umsetzung, Vernetzung und Finanzierung.- I 3.1 Inhaltliche und institutionelle Grundlagen der Biodiversitätskonvention.- I 3.2 Schwerpunkte der Umsetzung.- I 3.2.1 Innovative Strukturen in der Diskussion.- I 3.2.1.1 Einrichtung eines IPBD für die wissenschaftliche Beratung.- I 3.2.1.2 Erfolgskontrolle, Implementierung und Berichtswesen.- I 3.2.2 Informationsaustausch und Kapazitätsaufbau.- I 3.2.3 Arbeitsprogramme entlang der Zieltriade.- I 3.2.4 Ökosystemansatz.- I 3.2.5 Indikatoren und Monitoring.- I 3.2.6 Taxonomie.- I 3.2.7 Nichtheimische Arten.- I 3.2.8 „Terminator Technology“.- I 3.2.9 Zugang zu genetischen Ressourcen.- I 3.2.10 Indigene Völker und traditionelles Wissen: Geistige Eigentumsrechte.- I 3.3 Die Rolle der Biodiversitätskonvention im Institutionennetzwerk.- I 3.3.1 Erhaltung.- I 3.3.2 Nachhaltige Nutzung.- I 3.3.3 Vorteilsausgleich.- I 3.3.4 Die Umsetzung der CBD-Verpflichtungen innerhalb der EU am Beispiel der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.- I 3.4 Übereinkommen und Vereinbarungen des UNCED-Folgeprozesses.- I 3.4.1 Agenda 21 und die Kommission für nachhaltige Entwicklung.- I 3.4.2 Die Konvention zur Desertifikationsbekämpfung.- I 3.4.3 Die Klimarahmenkonvention.- I 3.4.4 Das Zwischenstaatliche Wälder-Forum.- I 3.5 Anreizinstrumente, Fonds und internationale Zusammenarbeit.- I 3.5.1 Anreizinstrumente.- I 3.5.2 Umweltfonds.- I 3.5.3 Entwicklungszusammenarbeit.- I 3.5.3.1 Aktivitäten zum Biospharenschutz.- I 3.5.3.2 Finanzierungsinstrumente.- J Forschungsstrategie für die Biosphäre.- J 1 Forschung zu den fünf biologischen Imperativen.- J 1.1 Integrität der Bioregionen bewahren.- J 1.2 Aktuelle biologische Ressourcen sichern.- J 1.3 Biopotentiale für die Zukunft erhalten.- J 1.4 Das globale Naturerbe bewahren.- J 1.5 Regelungsfunktionen der Biosphäre erhalten.- J 2 Methoden und Instrumente.- J 2.1 Indikatoren.- J 2.2 Biodiversitätsinformatik.- J 2.3 Monitoring und Fernerkundung.- J 3 Biosphärische Grundlagenforschung.- J 3.1 Biologisch-ökologische Grundlagenforschung.- J 3.1.1 Beschreibung und Inventarisierung biologischer Vielfalt (Taxonomie,Systematik).- J 3.1.2 Populationsbiologie und -genetik.- J 3.1.3 Funktionale Ökologie.- J 3.2 Sozioökonomische Grundlagenforschung.- J 3.2.1 Ethik.- J 3.2.2 Wahrnehmung und individuelle Bewertung.- J 3.2.3 Ökonomische Bewertung.- K Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Biosphärenpolitik.- K 1 Grundlagen einer Handlungsstrategie.- K 2 Schwerpunkte der Umsetzung.- K 2.1 Lokale Gemeinschaften, NRO, Umwelt- und Nutzerverbände.- K 2.1.1 Umweltbildung und Umweltlernen fördern.- K 2.1.2 Partizipation wichtiger lokaler Akteure sicherstellen.- K 2.1.3 Geistige Eigentumsrechte indigener Völker sichern.- K 2.2 Regierungen und staatliche Institutionen.- K 2.2.1 Nationale Umsetzung und Strategiefähigkeit verbessern.- K 2.2.2 Inhaltliche Ausgestaltung des Ökosystemansatzes vorantreiben.- K 2.2.3 Handlungsmöglichkeiten für einen biosphärenschonenden Konsum fördern.- K 2.2.4 Strategie des bioregionalen Managements in bestehende Planungsinstrumente integrieren.- K 2.2.5 Schutzgebiete: 10-20% der Flache für den Naturschutz reservieren.- K 2.2.6 Leitbild der „Multifunktionalen Landnutzung“ umsetzen.- K 2.2.7 Raum-zeitlicher Trennung von Stoffumsatzprozessen entgegenwirken.- K 2.2.8 Einbringung nichtheimischer Arten: Vorsorgend kontrollieren.- K 2.2.9 Vergleichbarkeit durch Indikatoren verbessern.- K 2.2.10 Interessenausgleich bei der Nutzung genetischer Ressourcen schaffen.- K 2.2.11 Attraktivität des Stiftungswesens steigern.- K 2.3 Nationale und multinationale Unternehmen.- K 2.3.1 Vorhaben der Bioprospektierung fördern.- K 2.3.2 Trend zur Selbstverpflichtung unterstützen.- K 2.4 Internationale Institutionen.- K 2.4.1 Positive Regelungen verbessern.- K 2.4.2 Zwischenstaatlichen Ausschuß für Biodiversität einrichten.- K 2.4.3 Protokollverhandlungen zur biologischen Sicherheit vorantreiben.- K 2.4.4 Erhaltung genetischer Ressourcen sicherstellen.- K 2.4.5 Globales System zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen stärken.- K 2.4.6 Richtlinien für nachhaltigen Tourismus und Biosphärenschutz voranbringen.- K 2.4.7 Handel mit bedrohten Arten: Kontrolle verbessern und Ausgleich schaffen.- K 2.4.8 Rechtlich bindendes Instrument zum Schutz der Walder voranbringen.- K 2.4.9 UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ stärken.- K 2.4.10 Welterbekonvention als Element einer globalen Erhaltungsstrategie fördern.- K 2.4.11 Globale Bodenkonvention entwickeln.- K 2.4.12 Ressourcenschutz in der Fischereipolitik fördern.- K 2.4.13 Koordination zwischen globalen Umweltabkommen verbessern.- K 2.4.14 Entwicklungszusammenarbeit als Instrument für den Biosphärenschutz stärken.- K 3 Finanzierung und internationale Zusammenarbeit.- K 3.1 Anreizsysteme vermehrt und kombiniert einsetzen.- K 3.2 Bi- und multilaterale Zusammenarbeit stärken.- K 3.3 „Naturpatenschaften“ als Instrument der Biosphärenpolitik entwickeln.- K 3.4 Ein weltweites Schutzgebietssystem ist finanzierbar.- L Literatur.- M Glossar.- N Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.- O Index.