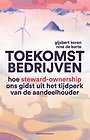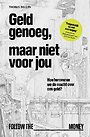Vorbemerkung.- I. Begriffskatalog.- 1. Die Entstellung von positiven und negativen Differentialrenten im Konjunkturablauf. 2. Das Wirtschaftssubjekt als Käufer und als Verkäufer auf verschiedenen Märkten. — Die Asynchronität der Preisverschiebungen als Ursache der Differentialrenten. — Der Begriff des „Lag“. — Das Verhältnis der Güter verschiedener Märkte als Produktions Verwandtschaft. 3. Theoretische Begründung des Lag der Preise; seine Typen..- II. Preisveränderungen.- 4. Terminologisches. — Kampf der Interessen, Machtverteilung durch monopoloide Vorteile und Nachteile gewisser Marktparteien. 5. Differenzierung des Wettbewerbes und der Elastizität der Nachfrage. 6. Bedeutung der markttechnischen Organisation für die Preisbildung. — Die Kolle der gesellschaftlichen Klassen auf den einzelnen Märkten. Ableitung der Veränderung ihrer Einkommensverhältnisse. — 7. Einteilung der Märkte nach ihrer Keagibilität. Nähere Erläuterung dieses Begriffes..- III. Die Gliederung der Märkte.- 8. Warenbörsen. 9. Märkte mit freier Wahl der Kontrahenten. 10. Monopoloide Märkte. 11. Monopolmärkte..- IV. Gruppierung der Preisempfänger (Verkäufer).- 12. Gesichtspunkt der Einteilung. — Urproduzenten. 13. Nichtorganisierte Lohnempfänger und Unternehmer. 14. Großhändler und Fabrikanten. 15. Kleinhändler und Handwerker. 16. Erzeuger von Markenartikeln. 17. Monopolisten. 18. Organisierte Arbeiter. 19. Public utilities. 20. Staat und umlageberechtigte Körperschaften..- V. Dieselben Wirtschaftssubjekte als Preiszahler (Käufer).- 21. Gegenüberstellung beider Funktionen. 22. Vorbehalte. 23. Tabelle 1: Das Gleichgewicht der Preise. 24. Tabellen 2—9, die Preissenkung durchschreitet die einzelnen Märkte. 25. Die Veränderung der Einkommen: Tabelle 10. 26. Die Differentialrenten: Tabelle 11. 27. Details hiezu: Tabelle 12. 28. Der wirkliche Ablauf der Preisverschiebungen..- VI. Mathematische Darstellung.- 29. Graphische Wiedergabe des bisherigen Ergebnisses. 30. Erste Annäherung; graphische und mathematische Darstellung. 31. Zweite Annäherung. — Einführung des Eeagibilitäts-Koeffizienten; gra phische und mathematische Darstellung. 32. Ausdehnung auf den gesamten Konjunkturablauf..- VII. Verluste infolge der Krise.- 33. Synchronität und Asynchronität von Käufen und Verkäufen. — Die Lagerhaltung und ihre Bedeutung im Konjunkturverlaufe. 34. Das Sinken der Geldpreise und die Verteilung der Güterbestände. — Verluste an Forderungen. 35. Einfluß der fiduziären Kredite. 36. Kapitalfehlleitungen. 37. Verluste durch Schrumpfung der Wirtschaft. 38. Arbeitslosigkeit. 39. Zeitweiliges Versagen des Unternehmungsgeistes. 40. Währungsverluste..- VIII. Konklusionen.- 41. Kritik interventionistischer Eingriffe der staatlichen Wirtschaftspolitik in die Preisbildung; Kreditausweitung; Schwierigkeit der Durchführung. 42. Devisenbewirtschaftung..- Namenverzeichnis.