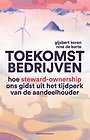Inhaltsübersicht.- I: Ordnungspolitische Grundregeln einer Politik für eine nachhaltige zukunftsverträgliche Entwicklung: Ziele, Institutionen und Instrumente.- 1 Nachhaltigkeit und Ordnungspolitik: Ziele der Arbeit und Vorgehensweise.- 2 Begriff der nachhaltigen Entwicklung.- 2.1 Definition.- 2.2 Allokation, Distribution und Skalierung.- 2.3 Ordnungspolitische Relevanz von Skalierungs- und Distributionsfragen.- 3 Analyseraster zur Beurteilung einer Politik der Nachhaltigkeit.- 3.1 Ordnungspolitische Grundlagen und Prinzipien.- 3.2 Entwicklung eines ordnungspolitischen Analyserasters.- 3.2.1 Überblick.- 3.2.2 Zieloperationalisierung und vertragstheoretische Legitimation.- 3.2.3 Wahl der Entscheidungsebene.- 3.2.4 Ökonomische Legitimation der Maßnahmengestaltung.- 3.3 Vergleich mit anderen Ansätzen.- 4 Elemente, Kriterien und Indikatoren zur Beschreibung von Nachhaltigkeit.- 4.1 Ökologische Entwicklung.- 4.1.1 Managementregeln und safe-minimum-standard.- 4.1.2 Entropie, Materialintensität und Umweltindikatoren.- 4.2 Soziale Entwicklung.- 4.2.1 Das neoklassische Konzept ökonomischer Nachhaltigkeit.- 4.2.2 Rawlssche Gerechtigkeitstheorie und Umweltraumkonzept.- 4.2.3 Gerechtigkeit und Gleichheit in politischen Erklärungen und Programmen.- 4.3 Ökonomische Entwicklung.- 4.4 Integration der Elemente: „Neue Wohlstandsmodelle“.- 4.4.1 Wohlfahrtsmessung und Nachhaltigkeitsindikatoren.- 4.4.2 Die Ableitung von Reduktionszielen.- 4.5 Zwischenergebnisse.- 5 Institutionen zur Verwirklichung einer Politik der Nachhaltigkeit.- 5.1 Subsidiarität und Nachhaltigkeit.- 5.2 Ökologische Räte: Institutionalisierung von Langzeitverantwortung.- 5.3 Internationalisierung der Umweltpolitik.- 5.4 Ein Umwelt-Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.- 5.4.1 Konzept und Aufgaben.- 5.4.2 Träger.- 5.4.3 Stellenwert internationaler Umweltschutzabkommen und der GEF.- 5.5 Reform von GATT/WTO.- 5.5.1 GATT-Konformität ökologisch motivierter Handelsbeschränkungen.- 5.5.2 Umwelt und Subventionen.- 5.5.3 Nutzbarkeit der GATT- bzw. WTO-Bestimmungen für ressourcenpolitische Maßnahmen.- 5.5.4 Beziehung von GATT/WTO zu bestehenden Umweltschutzabkommen.- 5.5.5 Reformvorschläge.- 5.6 Zwischenergebnisse.- 6 Instrumente zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung.- 6.1 Ordnungspolitik und Instrumente.- 6.2 Instrumententypen.- 6.3 Beurteilung der Instrumente nach Maßgabe des Kriterienkatalogs.- 6.3.1 Zielkonformität.- 6.3.2 Systemkonformität.- 6.3.3 Ökonomische Effizienz.- 6.3.4 Institutionelle Beherrschbarkeit.- 6.4 Zwischenergebnisse.- 7 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen.- 7.1 Ordnungspolitische Grundfragen.- 7.2 Zieloperationalisierung und Legitimierung.- 7.3 Institutionen zur Umsetzung einer Politik der Nachhaltigkeit.- 7.4 Instrumente zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung.- Anhang: Driving Force — State — Response Indicators.- II Ordnungspolitische Bewertung freiwilliger Selbstverpflichtungen der Wirtschaft im Umweltschutz.- 1 Zusammenfassende Gesamtbewertung freiwilliger Selbstverpflichtungen der Wirtschaft.- 1.1 Selbstverpflichtungen: weich, unfreiwillig und nicht marktwirtschaftlich.- 1.2 Hoheitlicher versus korporatistischer Ansatz in der Umweltpolitik.- 1.2.1 Politische Entscheidungsfindung.- 1.2.2 Durchsetzung der Vereinbarung.- 1.2.3 Ordnungspolitische Konsequenzen.- 1.2.4 Korporatistische versus hoheitliche Gestaltung des Ordnungsrahmens.- 1.3 Wahl der Fallbeispiele.- 1.3.1 Klimaschutz.- 1.3.2 Kreislaufwirtschaft.- 1.3.3 Integrierte Umwelttechnik.- 1.4 Zieloperationalisierung und Legitimation.- 1.4.1 Klimaschutz.- 1.4.2 Kreislaufwirtschaft.- 1.4.3 Integrierte Umwelttechnik.- 1.5 Wahl der Entscheidungsebene und Entscheidungsprozeß.- 1.5.1 Internationales Trittbrettfahrerverhalten forciert freiwillige Vereinbarungen.- 1.5.2 Selbstverpflichtungen entspringen einem „no regrets“- Ansatz.- 1.5.3 Zielverwässerung und Zielverzögerung.- 1.5.4 Selbstverpflichtungen als flankierendes Instrument.- 1.6 Instrumentendiskussion.- 1.6.1 Zielkonformität.- 1.6.1.1 FCKW-Selbstverpflichtung: zielkonform für bestimmte Verwendungen.- 1.6.1.2 Keine Impulse für absolute Emissionsreduktionen.- 1.6.1.3 „Business as usual“.- 1.6.1.4 Kombination mit ökonomischen Instrumenten sinnvoll.- 1.6.2 Systemkonformität.- 1.6.2.1 „Weiche“ Instrumente nur in der Vorsorgepolitik systemkonform.- 1.6.2.2 Keine Sanktionen gegen unfaire Mitspieler.- 1.6.2.3 Langfristig droht Interventionsspirale.- 1.6.2.4 Wettbewerbswirkungen freiwilliger Selbstbeschränkungen.- 1.6.2.5 Das Prinzip der Marktwirtschaft: faire Spielregeln statt Freiwilligkeit.- 1.6.2.6 Zur Möglichkeit marktwirtschaftlich ausgestalteter Selbstverpflichtungen.- 1.6.3 Ökonomische Effizienz.- 1.6.3.1 USA: Kosteneffizienter FCKW-Ausstieg mit Steuern und Zertifikaten.- 1.6.3.2 Selbstverpflichtungen führen nicht zu kostengünstigsten Anpassungen.- 1.6.3.3 Knappheitspreise effizienter.- 1.6.3.4 Grüner Punkt ökonomisch effizient.- 1.6.4 Institutionelle Beherrschbarkeit.- 1.6.4.1 Unverbindliche Zusagen.- 1.6.4.2 Umverteilung zu Lasten Dritter.- 1.6.4.3 Preisgabe politischer Handlungsspielräume.- 1.7 Fazit.- 2 Freiwillige Umweltschutzmaßnahmen der Wirtschaft: Einordnung und Überblick.- 2.1 „Harte“ und „weiche“ Instrumente in der Umweltpolitik.- 2.2 Freiwillige Selbstverpflichtungen: Begriff und Kontroverse.- 2.3 Selbstverpflichtungen: kein marktwirtschaftliches Instrument.- 2.4 Hoheitlicher versus korporatistischer Ansatz in der Umweltpolitik.- 2.5 Überblick über den weiteren Untersuchungsgang.- 3 Rechtliche und rechtspolitische Grundlagen.- 3.1 Umsetzung des Kooperationsprinzips.- 3.2 Durchsetzung der Vereinbarungen.- 3.3 Rechtsstaatliche Aspekte.- 3.4 Demokratische Aspekte.- 4 Ordnungspolitische Grundlagen.- 4.1 Ordnungspolitik und Umweltpolitik.- 4.2 Ordnungspolitik und freiwillige Selbstverpflichtungen.- 5 Methodische Vorgehensweise.- 5.1 Prüfschema.- 5.2 Bestimmung von Umweltzielen und Auswahl ordnungspolitisch besonders relevanter Fallbeispiele.- 5.3 Entscheidungsebene: Das Problem der Verlagerung von politischer Verantwortung.- 5.4 Instrumentenebene: Überprüfung der ökonomischen Legitimation von freiwilligen Selbstverpflichtungen.- 5.4.1 Prüfung auf Zielkonformität.- 5.4.2 Prüfung auf Systemkonformität.- 5.4.3 Prüfung auf Effizienz.- 5.4.4 Prüfung institutioneller Beherrschbarkeit.- 6 Fallbeispiel Klimaschutz.- 6.1 Zielebene.- 6.1.1 Problembeschreibung.- 6.1.2 Zieloperationalisierung und Legitimation.- 6.1.2.1 Reduktionsziele im Klimaschutz.- 6.1.2.2 Fallbeispiel FCKW.- 6.1.2.3 Fallbeispiel CO2.- 6.2 Entscheidungsebene.- 6.3 Instrumentenebene.- 6.3.1 Zielkonformität.- 6.3.1.1 Fallbeispiel FCKW.- 6.3.1.2 Fallbeispiel CO2.- 6.3.2 Systemkonformität.- 6.3.2.1 Fallbeispiel FCKW.- 6.3.2.2 Fallbeispiel CO2.- 6.3.3 Ökonomische Effizienz.- 6.3.3.1 Fallbeispiel FCKW.- 6.3.3.2 Fallbeispiel CO2.- 6.3.4 Institutionelle Beherrschbarkeit.- 6.3.4.1 Fallbeispiel FCKW.- 6.3.4.2 Fallbeispiel CO2.- 7 Fallbeispiel Kreislaufwirtschaft.- 7.1 Zielebene.- 7.1.1 Problembeschreibung.- 7.1.2 Zieloperationalisierung und Legitimation.- 7.1.2.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.1.2.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.2 Entscheidungsebene.- 7.2.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.2.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3 Instrumentenebene.- 7.3.1 Theoretisch optimale Instrumentenwahl.- 7.3.1.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.1.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3.2 Zielkonformität.- 7.3.2.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.2.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3.3 Systemkonformität.- 7.3.3.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.3.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3.4 Ökonomische Effizienz.- 7.3.4.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.4.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3.5 Institutionelle Beherrschbarkeit.- 7.3.5.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.5.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 7.3.6 Abschließende Bewertung.- 7.3.6.1 Fallbeispiel Altautorücknahme.- 7.3.6.2 Fallbeispiel Verpackungsmüll.- 8 Fallbeispiel Integrierte Umweltschutztechnik.- 8.1 Zielebene.- 8.1.1 Problembeschreibung.- 8.1.2 Zieloperationalisierung und Legitimation.- 8.2 Entscheidungsebene.- 8.3 Instrumentenebene.- 8.3.1 Zielkonformität.- 8.3.2 Systemkonformität.- 8.3.3 Ökonomische Effizienz.- 8.3.4 Institutionelle Beherrschbarkeit.- A 1: Freiwillige Selbstverpflichtungen im Klimaschutz in ausgewählten Ländern.- A 2: Übersicht über die aktualisierten Selbstverpflichtungen der deutschen Industrie im Klimaschutz vom März 1996.