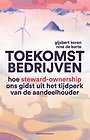I: Learning by Doing als Determinante des Außenhandels.- II: Bausteine der dynamischen Modelle offener Volkswirtschaften.- 1 Das neoklassische Zwei-Sektoren-Modell.- 1.1 Der Produktionssektor.- 1.1.1 Erfassung der Produktionsmöglichkeiten.- 1.1.2 Der Produktionssektor bei vollständiger Konkurrenz.- 1.1.3 Die Erlösfunktion und die Kostenfunktion.- 1.2 Der Haushaltssektor.- 1.2.1 Grundlegende Annahmen.- 1.2.2 Die Gorman-Form der Präferenzen.- 1.2.3 Kompensationskriterien.- 1.2.4 Samuelsons gesellschaftliche Nutzenfunktion.- 1.2.5 Eigenschaften der Nachfragefunktionen.- 1.3 Das Gleichgewicht bei Autarkie.- 1.4 Das Außenhandelsgleichgewicht.- 1.4.1 Der Fall des kleinen Landes.- 1.4.2 Der Zwei-Länder-Fall.- 1.5 Die Richtungen des Außenhandels.- 1.5.1 Komparative Vorteile.- 1.5.2 Ursachen für komparative Vorteile.- 1.6 Zusammenfassung.- 1.7 Anhang zu Abschnitt II.1.- 1.7.1 Der Zusammenhang zwischen den Konkavitätsanforderungen.- 1.7.2 Beweis des Hilfssatzes II.3.- 1.7.3 Beweis des Hilfssatzes II.7.- 1.7.4 Berechnung des Substitutionseffektes.- 2 Dynamische Skalenerträge durch Learning by Doing.- 2.1 Gegenstand der Analyse.- 2.2 Arten der Skalenerträge.- 2.2.1 Interne Skalenerträge.- (a) Statische Skalenerträge.- (b) Dynamische Skalenerträge.- 2.2.2 Externe Skalenerträge.- (a) Statische Skalenerträge.- (b) Dynamische Skalenerträge.- 2.3 Die Marktform bei internen dynamischen Skalenerträgen.- 2.3.1 Die Produktionsentscheidung im Angebotsmonopol.- 2.3.2 Maximierung des Wohlstands.- 2.3.3 Die Marktform bei freiem Markteintritt.- 2.4 Empirische Schätzung von Lernelastizitäten.- 2.4.1 Schätzung der Lernfunktion.- 2.4.2 Schätzung der Lernkurve.- 2.4.3 Vergleich der beiden Ansätze.- 2.5 Zusammenfassung.- III: Dynamische Außenhandelstheorie.- 1 Learning by Doing in der positiven Außenhandelstheorie.- 1.1 Die Produktionstechnologie in der Außenhandelstheorie.- 1.2 Endogene komparative Vorteile durch Learning by Doing.- 1.2.1 Die Situation bei Autarkie.- (a) Formulierung des Modells.- (b) Preiseffekte bei Parametervariationen.- (c) Dynamische Analyse des Modells.- (d) Komparativ-statische Analyse des langfristigen Gleichgewichtes.- (e) Bedeutung der Ergebnisse.- 1.2.2 Der Fall des kleinen Landes.- (a) Formulierung des Modells.- (b) Dynamische Analyse des Modells.- (c) Komparativ-statische Analyse des langfristigen Gleichgewichtes.- (d) Bedeutung der Ergebnisse.- 1.2.3 Der Zwei-Länder-Fall.- (a) Formulierung des Modells.- (b) Preiseffekte bei Parametervariationen.- (c) Dynamische Analyse des Modells.- (d) Komparativ-statische Analyse des langfristigen Gleichgewichtes.- (e) Bedeutung der Ergebnisse.- 1.3 Learning by Doing in der Neuen Wachstumstheorie.- 1.3.1 Die Ansatzpunkte der Neuen Wachstumstheorie.- 1.3.2 Learning by Doing in einem ricardianischen Modell.- (a) Formulierung des Modells.- (b) Dynamische Analyse der Autarkie-Situation.- (c) Dynamische Analyse der Lage bei Freihandel.- (d) Bedeutung der Ergebnisse.- 1.4 Zusammenfassung.- 1.5 Anhang zu Abschnitt III.1.- 1.5.1 Mathematica-Notebook zum Fall des kleinen Landes..- 1.5.2 Mathematica-Notebook zum Zwei-Länder-Fall.- 1.5.3 Beweis des Hilfssatzes III.3.- 2 Learning by Doing in der normativen Außenhandelstheorie.- 2.1 Das Erziehungsargument der Protektion.- 2.1.1 Das Mill-Bastable-Dogma.- 2.1.2 Kritik des Mill-Bastable-Dogmas.- 2.1.3 Ein Referenzmodell.- 2.2 Interne Lerneffekte als Grundlage des Erziehungsarguments.- 2.2.1 Unvollkommene Voraussicht.- 2.2.2 Unvollkommener Kapitalmarkt.- 2.2.3 Pekuniäre externe Effekte.- 2.3 Externe Lerneffekte als Grundlage des Erziehungsarguments..- 2.3.1 Ursachen für dynamische externe Effekte.- 2.3.2 Ein Zwei-Perioden-Modell mit externen Lerneffekten..- (a) Der Zwei-Länder-Fall.- (b) Der Fall des kleinen Landes.- (c) Eine intertemporale Grenzrate der Transformation.- 2.4 Die Dynamik der optimalen Erziehungssubventionen bei externen Lerneffekten.- 2.4.1 Formulierung des Modells.- 2.4.2 Analytische Lösung des Modells.- (a) Diversifikation der Produktion.- (b) Spezialisierung der Produktion.- 2.4.3 Graphische Darstellung der optimalen Lösung.- 2.4.4 Der Fall der CEL-Funktion.- 2.4.5 Weitere Ergebnisse.- (a) Verallgemeinerungen.- (b) Berücksichtigung der Faktorausstattung.- (c) Lerneffekte in einem Sektor.- (d) Unendlicher Planungszeitraum.- (e) Akkumulation von Humankapital.- (f) Erweiterung auf ein Mehr-Sektoren-Modell.- 2.5 Zusammenfassung.- 2.6 Anhang zu Abschnitt III.2.- 2.6.1 Beweis des Satzes C-W 3.- 2.6.2 Kumulierte Produktion im CEL-Fall.- 2.6.3 Beweis des Satzes C-W 5 (CEL).- 2.6.4 Beweis des Satzes C-W 6.- 2.6.5 Beweis des Hilfesatzes zu Satz C-W 7.- 2.6.6 Beweis des Satzes C-W 8.- 2.6.7 Beweis des Satzes C-W 9.- IV: Kritische Würdigung der Ansätze.- Mathematischer Anhang.- A.1 Vorbemerkung.- A.2 Grundlagen aus der Analysis.- A.2.2 Punktionen.- A.3 Homogene Funktionen.- A.4 Konkave und quasikonkave Funktionen.- A.4.1 Konkave Funktionen.- A.4.2 Quasikonkave Funktionen.- A.5 Nichtlineare Programmierung.- A.5.1 Maximierungsprobleme.- A.5.2 Nebenbedingungen in Form von Gleichungen.- A.5.3 Existenz und Eindeutigkeit optimaler Lösungen.- A.5.4 Minimierungsprobleme.- A.6 Der Satz über implizite Funktionen.- A.7 Der Umhüllendensatz.- A.8 Differentialgleichungen und dynamische Systeme.- A.8.1 Grundlagen.- A.8.2 Lineare Approximationen.- A.8.3 Phasendiagramme.- A.8.4 Geschlossene Trajektorien.- A.9 Kontrolltheorie.- Stichwortverzeichnis.