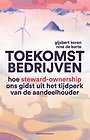I. Zentralstaatliche Modernisierung oder Dezentrale Innovation.- I.A. Veränderte Akkumulationsbedingungen und neokonservative Regulation.- 1. Prosperität und Krise: Erfolg und Einbruch des keynesianischsozialdemokratischen Projekts.- 1.1. Ein Blick zurück.- 1.2. Die Voraussetzungen der langanhaltenden Wachstumsproduktion.- 1.3. Die keynesianisch-sozialdemokratische Ausweitung staatlicher Intervention.- 1.4. Zwischen Anerkennung und Adaption: Die verkürzte Interessenwahrung der Lohnabhängigen.- 1.5. Der Weg in die Krise.- 2. Vor einem neuen kapitalorientierten Akkumulationsmodell.- 2.1. Die Konturen.- 2.2. Der dominante ökonomisch-technische Entwicklungspfad.- 2.3. Mikroökonomische Fundierung: Neue Produktionskonzepte und neue innerbetriebliche Hierarchien.- 2.4. Staatspolitische Regulation und die Veränderung des Kräftegleichgewichts.- 2.4.1. Die Durchsetzung kapitalorientierter Modernisierungsstrategien.- 2.4.2. Die Abwendung vom keynesianischen Klassenkompromiß.- 2.5. Das sozialreformerische Spektrum vor der Diffusion?.- 3. Der Wandel zentralstaatlicher Regulierungsstrategien in der Bundesrepublik.- 3.1. Das Ende sozial-liberaler Reformpolitik in der Phase der Stagnation.- 3.2. Die Neuausrichtung staatlicher Krisenpolitik durch die konservativ-liberale Koalition.- 3.2.1. Modernisierung im konservativ-technokratischen Staat.- 3.2.2. Sozial- und arbeitsmarktpolitische Deregulation.- 3.3. Die Verschiebung der Krisenlasten auf Kommune und Region.- 3.3.1. Neue Disparitäten zwischen den Regionen.- 3.3.2. Regionale Konkurrenz als Teil des neokonservativen Konzepts.- 3.3.3. Staatspolitische Problemverlagerung und lokale Polarisierungen.- I.B. Ein alternativer gesellschaftlicher Entwicklungstyp.- 1. Die soziale Trägerschaft — ein noch lückenhaftes Fundament.- 2. Eckpunkte einer arbeitsorientierten Umbaukonzeption.- 3. Die Felder des qualitativen Programmbedarfs.- 4. Zum Verhältnis von zentraler und dezentraler Politik.- 5. Mobilisierung und Demokratisierung als Erfolgsbedingungen.- II. Chancen Lokaler Gegenmacht.- II.A. Lokale Politik als abhängiger und offener Prozeß.- 1. Der Stellenwert lokaler Politik in der Bundesrepublik.- 1.1. Die Rahmenbedingungen.- 1.2. Die Politisierung »von unten« hat Konjunkturen.- 2. Zentralstaatliche Determinierung oder strukturelle Autonomie? Eine unfruchtbare Kontroverse in den Hauptströmungen der kommunalwissenschaftlichen Theorie.- 2.1. Die kommunale Ebene als Instrument zentralstaatlicher Strategien.- 2.2. Die Kommune als notwendig progressiver Teil einer dualistischen Staatsstruktur.- 2.3. Wider einseitige Festlegungen des lokalen Politikgehalts.- 3. Lokale Politik als Bestandteil interessengeleiteter gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.- 3.1. Relative Autonomie durch lokalspezifische Kräfteverhältnisse im ungleichzeitigen Entwicklungsprozeß.- 3.2. Lokale Gegenmachtpolitik — eine historische Reminiszenz?.- 3.3. Die Vernachlässigung der kommunalen Ebene bei der Formulierung sozialreformerischer Strategien.- 3.4. Voraussetzungen lokaler Gegenmachtpolitik in der aktuellen gesellschaftlichen Situation.- II.B. Exkurs: Lokale Gegenmachtpolitik in der aktuellen Restrukturierungskrise. Das Beispiel der radikalen Stadtregionen Großbritanniens.- 1. Die Politik der britischen Zentralregierung im Umgang mit den Kommunen.- 2. »Restructuring for Labour« als dezentrale Gegenstrategie.- 3. Konzepte und Praxis der Kommunalregierungen.- 3.1. Erste Erfahrungen in den West Midlands und in Sheffield.- 3.1.1. West Midlands County Council.- 3.1.2. Sheffield City.- 3.2. Der strategische Gesamtansatz des Greater London Council.- 3.2.1. Neue Konzepte und Organisationsstrukturen.- 3.2.2. Demokratische Formen der Bedarfsermittlung und Planungsbeteiligung.- 3.2.3. Technologieberatung und Produktinnovation.- 4. Erfolge und Grenzen der neuen lokalpolitischen Ansätze.- III. Zwischen Neuen Handlungsanforderungen und Alten Rezepturen: Zur Praxis Kommunalen Krisenmanagements.- 1. Kommunale Haushaltspolitik: Staatsstrukturelle Belastungen und örtliche Konsolidierungsstrategien.- 1.1. Prozyklische Haushaltskonjunkturen.- 1.2. Die staatliche Aushöhlung der kommunalen Finanzposition.- 1.3. Die Polarisierung der fmanziellen Handlungsspielräume.- 1.4. Krisenverschärfung durch kameralistische Budgetpolitik.- 2. Alte und neue Wege kapitalorientierter lokaler Wirtschaftsförderung.- 2.1. Kommunale Interventionsmuster im Zeichen der traditionellen Ämter- und »Policystruktur«.- 2.2. Der halbherzige Wechsel von der Neuansiedlungsförderung zur bestandsorientierten Politik.- 2.3. Die Modernisierungsvariante: Kommunale Technologie- und Gründerparks.- 3. Die Wiederentdeckung der Arbeitsbeschaffung als kommunales Aufgabengebiet.- 3.1. Die beiden Säulen des »zweiten Arbeitsmarktes«.- 3.2. Die staatspolitische Progammierung von ABM.- 3.3. Kommunale »Hilfe zur Arbeit« — ein ambivalentes Instrument.- 3.4. Der »zweite Arbeitsmarkt« als entpolitisierter Maßnahmenvollzug. Zur praktischen Ausgestaltung der Arbeitsbeschaffung in der kommunalen Politik.- IV. Die Auseinandersetzung um Eine Beschäftigungssichernde Lokale Strategie.- 1. Ein neues Paradigma in der lokalen Diskussion: Das Konzept gewerkschaftlicher Entwicklungszentren als Anstoß für eine integrierte kommunale Politik.- 2. Das Zentrum Arbeit, Technik, Umwelt in Mittelfranken.- 2.1. Ursprungskonzeption.- 2.2. Realisierungsstand.- 2.3. Nur als Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen toleriert.- 3. Das Entwicklungs-Centrum Osnabrück.- 3.1. Die ECOS-Idee.- 3.2. Widrige Bedingungen der Verwirklichung.- 3.3. ECOS als Beratungsagentur.- 4. Das Entwicklungszentrum Dortmund.- 4.1. Beschäftigungssichernde Kommunalpolitik als Thema der gewerkschaftlichen Diskussion.- 4.2. Das EWZ-Konzept.- 4.3. Der praktische Versuch, Entwicklung, Qualifizierung und Beratung zu integrieren.- 4.4. Die Abhängigkeit von »Fördertöpfen« bleibt bestehen.- 4.5. Wo Rat und Verwaltung Prioritäten setzen.- 4.5.1. Aktivitätszuwachs ohne integratives Konzept.- 4.5.2. Das »neue Mix« der unternehmensorientierten Dortmunder Wirtschaftsförderungspolitik.- 4.5.3. Die Förderung des »Faktors Arbeit« bleibt zurück.- 4.6. Das EWZ als Randprojekt der Dortmunder Modernisierungspolitik?.- 5. Konzeptioneller Anspruch und kommunalpolitische Realität — Erfahrungen aus der ersten Phase lokaler Auseinandersetzungen.- 6. Programm und Perspektiven einer dezentralen Innovations- und Beschäftigungsstrategie.- 6.1. Vor einer neuen Etappe des Konflikts.- 6.2. Den lokalen Handlungsbedarf ermitteln und seine fachpolitische Umsetzung organisieren.- 6.3. Die kommunalen Ressourcen umfassend mobilisieren.- 6.4. Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Strategien zusammenführen.- 6.5. Betrieb und Kommune politisieren.- Literatur.