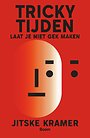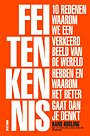1 Das Problem steigender Ausfälle bei Bevölkerungsumfragen.- 1.1 Das Ansteigen des Nonresponse als Argument gegen Zufallsstichproben.- 1.2 Vorarbeiten zur empirischen Klärung des Problems steigender Ausfälle.- 1.2.1 Nonresponse-Definition.- 1.2.2 Die Kategorisierung der Ausfallursachen bei Unit-Nonresponse.- 1.2.3 Definition von Ausschöpfungsquoten.- 1.2.3.1 „Neutrale“ und „systematische Ausfälle“.- 1.2.3.1.1 Nichtbearbeitete Adressen und Totalausfälle von S ampling-Points.- 1.2.3.1.2 Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit.- 1.2.3.1.3 Sonstige systematische Ursachen „neutraler“ Ausfälle.- 1.2.3.2 Abschließende Bemerkungen zur Definition der Ausschöpfungsquote.- 2 Empirische Studien zum Ansteigen des Unit-Nonresponse außerhalb der BRD.- 2.1 Amtliche Erhebungen.- 2.2 Akademische und kommerzielle Surveys.- 2.3 Zusammenfassung.- 3 Entwicklung des Unit-Nonresponse in der Bundesrepublik.- 3.1 Konstituierung einer Nonresponse-Zeitreihe für die Bundesrepublik.- 3.1.1 Zugang zu Feldberichten.- 3.1.2 Erfassung der Feldberichte des Zentralarchivs.- 3.1.3 Datenbereinigung.- 3.1.4 Beschreibung der Datenbasis.- 3.1.5 Definition der verwendeten Variablen.- 3.2 Methodische Probleme der Konstituierung einer Nonresponse-Zeitreihe.- 3.2.1 Selbstselektion der Erhebungen.- 3.2.2 Veränderungen der Grundgesamtheit.- 3.2.3 Veränderungen der Stichprobenverfahren.- 3.2.4 Veränderungen der Feldprozeduren.- 3.2.5 Validität der Feldberichte.- 3.2.6 Beurteilung der methodischen Probleme.- 3.3 Zum Vergleich von Stichprobenergebnissen aus Bevölkerungsumfragen.- 3.4 Entwicklung des Nonresponse 1953-1994.- 3.4.1 „Stichprobenneutrale“ Ausfälle.- 3.4.2 „Systematische“ Ausfälle.- 3.4.2.1 Entwicklung der Ausschöpfungsrate.- 3.4.2.2 Entwicklung der Verweigerungsrate.- 3.4.2.3 Entwicklung der Erreichbarkeit.- 3.4.2.3.1 Institutseffekte bei der Nichterreichbarkeit.- 3.4.2.3.2 Veränderung der Anzahl der Kontaktversuche bis zum Interview.- 3.4.2.3.3 Schlußfolgerung.- 3.4.2.4 „Zielperson in Urlaub“.- 3.4.2.5 Entwicklung des Anteils der Erkrankten.- 3.4.2.6 Restkategorien: „zu spät eingetroffen“, Fälschungen, Sprachprobleme, sonstige Ausfallursachen.- 3.4.3 Exkurs: Ausfälle in Telefonsurveys.- 3.4.3.1 Nichtkontaktierte und nichterreichte Anschlüsse und Zielpersonen.- 3.4.3.2 Verweigerungen.- 3.4.3.3 Abgebrochene Interviews und „sonstige Ausfälle“.- 3.4.3.4 Entwicklung der Ausschöpfungsrate.- 3.4.3.5 Zusammenfassende Beurteilung.- 3.5 Größenordnung der Ausfallursachen bei neueren Erhebungen.- 3.6 Schlußfolgerungen.- 4 Theoretische Erklärungen und empirische Korrelate des Nonresponse.- 4.1 Methodische Ansätze zur Untersuchung von Nonrespondenten.- 4.1.1 Forschungsdesigns zur Untersuchung von Nonresponse.- 4.1.1.1 Vergleich von Aggregatstatistiken mit Stichprobenergebnissen.- 4.1.1.2 Individueller Vergleich mit Zensus-Daten.- 4.1.1.3 Individueller Vergleich mit Sampling-Frame-Daten.- 4.1.1.4 Untersuchung von ehemaligen Befragungsteilnehmern.- 4.1.1.5 Extrapolation auf der Grundlage der Schwierigkeit des Interviews.- 4.1.1.6 Interviewerschätzungen.- 4.1.1.7 Angegebene Verweigerungs- und Teilnahmegründe.- 4.1.1.8 Angaben konvertierter Verweigerer.- 4.1.2 Weitere Probleme der empirischen Nonresponse-Forschung.- 4.2 Eine allgemeine Theorie des Teilnahmeverhaltens.- 4.2.1 „Rational-Choice“ als Grundlage einer Theorie des Teilnahmeverhaltens.- 4.2.1.1 Einwilligungs- und Verweigerungsheuristiken als habitualisierte Verhaltenstendenzen.- 4.2.1.2 Skripttheoretische Spezifizierung der RC-Theorie.- 4.2.1.3 Interviewer-Kontaktperson-Interaktion als Skriptidentifikation.- 4.2.2 Empirische Einzelhypothesen als Spezialfälle von RC-Theorien.- 4.2.2.1 Befragung als „Belastung“.- 4.2.2.2 Hilfsbereitschaft.- 4.2.2.3 Wohnortgröße und Kriminalitätsfurcht.- 4.2.2.4 Altersbedingte Ausfälle.- 4.2.2.5 Subjektive Bedeutsamkeit des Untersuchungsthemas für den Befragten.- 4.2.2.6 Materielle Anreize für die Befragten.- 4.2.2.7 Habituelle Verweigerer: „Hard core“-Nonresponse.- 4.2.2.8 Interviewermerkmale.- 4.2.2.9 „Demographie der Ausfälle“ als Beispiel für unvollständige Erklärungen.- 4.2.3 Zusammenfassung und Diskussion der RC-Theorien des Teilnahmeverhaltens.- 4.2.4 Exkurs: Zu einem neueren Test der „‚Rational Choice‘-Annahme“.- 4.3 Teilnahme und Verweigerung als rationales Handeln.- 5 Ursachen unterschiedlicher Erreichbarkeit der Zielpersonen.- 5.1 Subgruppen schwer erreichbarer Zielpersonen.- 5.2 Modelle zur Erklärung der Erreichbarkeit.- 5.3 Empirische Untersuchungen zum Kontaktverhalten der Interviewer.- 5.4 Einzelheiten der Feldarbeit in Standardsurveys.- 5.5 Größenordnung schwer erreichbarer Subgruppen.- 5.5.1 Urlaubsreisende.- 5.5.2 Krankenhausaufenthalte.- 5.6 Möglichkeiten der Mikrosimulation der Feldarbeit.- 6 Zur Möglichkeit der Korrektur von Nonresponse.- 6.1 Gewichtungsverfahren.- 6.2 Sample-Selection-Modelle.- 6.3 Propensity-Modelle.- 6.4 Bewertung der Korrekturverfahren.- 7 Empfehlungen für die Durchführung von Erhebungen.- 7.1 Professionalisierung der Surveys.- 7.2 Etablierung einer akademisch orientierten Erhebungsorganisation.- 7.3 Veränderung der Erhebungsform.- 7.4 Verbesserungen in der Instrumentenkonstruktion.- 7.5 Verbesserung der Interviewerausbildung und Supervision.- 7.6 Verbesserung der Feldprozeduren.- 7.6.1 Kontaktaufnahme.- 7.6.2 Konvertierung von Verweigerern.- 7.6.3 Dokumentation der Kontaktaufnahme.- 7.6.4 Verwendung von Interviewer- und Proxyangaben.- 7.6.5 Zusammenfassung.- 7.7 Dokumentation und Diskussion der Feldarbeit.- 7.8 Schlußbemerkung.- A Datensatzbeschreibung der Feldberichte.- B Bestandteile einer Studiendokumentation.- C Designeffekte in sozialwissenschaftlichen Surveys.- C.1 Designeffekte und die Zahl der Samplingpoints.- C.2 Designeffekte in CATI-Surveys.- C.3 Der Einfluß des Interviewers auf die Wiederbefragbarkeit der Befragten.- C.4 Modelle zur Schätzung von Interviewereffekten für dichotome abhängige Variablen.