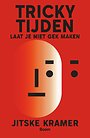Inhaltsübersicht.- 1. Einführung.- 1.1 Intention.- 1.2 Überblick.- Das Forschungs- und Entwicklungs-Projekt „Transfer eines Risiko-Bewertungs-Systems für kontaminierte Böden in ostasiatische Rechts- und Verwaltungssysteme“.- Das „Risiko-Bewertungs-System“ des Projekts — Der Beitrag der Naturwissenschaften.- Bodenschutz aus naturwissenschaftlicher Sicht.- FAGUS-Ansatz für ein Risiko-Bewertungs-System für Schadstoffe in Böden.- Anmerkungen zum „Grundtext“.- Aus der Einführung zum Workshop.- 2. Vom Boden.- 2.1 Boden und Bodenschutz in soziologischer Betrachtung.- 2.1.1 Erste Annäherung.- 2.1.2 Standpunkt.- 2.1.3 Umgang mit Böden und Flächen.- 2.1.3.1 Einbettung von Böden und Flächen in Nutzungszusammenhänge.- 2.1.3.2 Planungsphilosophie zum Bodenschutz: Anwendungsbezug.- 2.1.3.3 Zielvorstellungen und Kriterien zum Bodenschutz.- 2.1.3.3.1 Wirtschaftliche Nachhaltigkeit.- 2.1.3.3.2 Ökologische Nachhaltigkeit.- 2.1.3.3.3 Soziale Nachhaltigkeit.- 2.1.3.4 Zusammenfassende Überlegungen.- Wissenschaft und Umweltpolitik.- Exkurs zu Naturnähe (§1 u. 2 BbodSchG).- Folgerungen.- Bodenschutz.- Anmerkungen zum „Grundtext“.- Allgemeines.- Zur Rollenanalyse.- Zur Interaktionsanalyse.- Zur Risikoanalyse.- Zur Bedeutung der Umweltmedien.- Bodenschutz in Deutschland.- 2.2 Über die Bedeutung des Bodens im geschichtlichen Wandel.- 2.2.1 Boden, Landschaft und Landwirtschaft.- 2.2.1.1 Landschaft und Boden in der fraheuropäischen Entwicklung.- 2.2.1.2 Der lange Weg aus dem „Mittelalter“ in die „Neuzeit“.- 2.2.1.3 Boden im Verständnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.- 2.2.2 Aktuelle Kontroversen und weiterführende Sichtweisen.- 2.2.2.1 Der offizielle Stand.- 2.2.2.2 Eine zeitkritische Stimme.- 2.3 Zwischenbilanz.- 3. Sozialwissenschaften, Natur und Bodenschutz.- 3.1 Soziologische Vorbereitung.- 3.1.1 Sozialwissenschaften zum Bodenschutz.- 3.1.2 Der soziale Entstehungszusammenhang von gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz (Legigenese).- 3.2 Bodenschutz aus sozial wissenschaftlicher Sicht.- 3.2.1 Umwelt, Recht und Umweltschutz.- 3.2.1.1 Sozialwissenschaftliche Fragestellungen.- 3.2.1.2 Akteure handeln auf unterschiedlichen Ebenen.- 3.2.2 Humanökologie: Gesellschaft und Umwelt.- Interaktionsanalyse.- Bodenschutz: Bedeutung und ihre sozialwissenschaftliche Rezeption.- Bodenschutz: Akteure und Interaktionen.- Das zeitliche Mißverhältnis zwischen Bodenbildung und Bodenzerstörung wird ungenügend beachtet.- Die Bedeutung der Landwirtschaft nimmt weltweit ab, andere Flächennutzungen nehmen zu.- Wirtschaftliche Kurzsichtigkeit widerspricht den langfristigen Bodenprozessen — Bodendegradation wird als Problem des Südens gesehen.- Die Problemwahrnehmung wird verzögert.- Gesellschaftliche Aktivitäten am Interface zur Natur: Stoffwechsel und Kolonisierung.- Gesellschaftlicher Stoffwechsel und Bodennutzung.- Kolonisierung natürlicher Systeme und die Folgen für den Boden.- 3.3 Soziologische Ansichten vom Handeln.- 3.3.1 Umwelthandeln und Umweltbewußtsein.- 3.3.2 Bedingtheit des Handelns.- Kulturelle Muster und Bodenschutz.- Einleitende Frage.- Paradoxien der Umweltwahrnehmung und Umweltbeziehung.- Die Externalisierung von Natur im Verlauf der Entwicklung der modernen Stadt.- Eine vorsorgende Bodenschutzpolitik bedarf der Inwertsetzung des Bodens.- Die Landschaft der Stadt als Raumkonzept nachhaltiger Entwicklung.- Überlegungen zum ungleichheitsbedingten (Umwelt-)Handeln.- Eine Theorie strukturbedingten Handelns.- Relevanz der Erkenntnis aus strukturabhängigen Handlungstheorien für Akteure im Umweltschutz.- Symbolisch-interaktionistische Theorie und ihr Beitrag zur Analyse des Umweltschutzes.- Die Randständigkeit des interaktionistischen Ansatzes der Chicago-Soziologie in den Diskursen der heutigen Umwelt-Soziologie und die Dominanz der nutzentheoretischen Handlungskonzeptionen der Spieltheorie und des „rational choice“-Ansatzes.- Das Modell kooperativen Interaktion als Kernbereich der theoretischen Vorstellungen der Chicago-Soziologie und des Symbolischen Interaktionismus.- Interaktionistische Leitsätze für die Analyse der Thematisierung von Umweltproblemen sowie die Potentiale und Schwierigkeiten der Umweltschutz-Arbeit.- Betrachtungsdimensionen der Chicago-Soziologie und des Symbolischen Interaktionismus jenseits der Grundlagentheorie der kooperationsbezogenen Interaktions-, Handlungs- und Identitätssphäre: ein Hinweis.- Schlußbemerkung.- Routinehandeln.- Diskussion.- 3.4 Ansichten davon, was ein Risiko sei.- 3.5 Konsequentes Handeln der Umweltakteure.- 3.5.1 Kooperation unter Umweltakteuren.- 3.5.1.1 Die „Tragödie der Allmende“.- 3.5.1.2 Gefangenen-Dilemmata.- 3.5.1.3 Degradations-Dilemmata.- 3.5.2 Die Spielfelder „Schutz der Umwelt“ und „Pflege des Bodens“.- 3.5.2.1 Kooperation unter Egoisten ist möglich.- 3.5.2.2 Die Logik der Kooperation in Institutionen und die Verfahrensregeln.- Zum Einsatz der Spieltheorie in den Sozial wissenschaften, insbesondere mit Blick auf die Umweltproblematik.- Bodenwirtschaft und Bodenpolitik in wirtschaftswissenschaftlicher Sicht.- 4. Bewertungen im Blick der Disziplinen.- 4.1 Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu Regelungen zum Bodenschutz.- 4.2 Multidisziplinäre Wahrnehmungen.- 4.2.1 Der Nachweis von Problemen und ihre Lösung.- Einführende Bemerkung zur Diskussion von Interaktionsund Kommunikationsproblemen (Konflikten) im Umweltbereich.- Alltagsakteure im Umweltschutz: Kommentare aus der Sicht der Ver- und Entsorgung.- Einleitende Bemerkungen.- Zur Rollenanalyse.- Zur Interaktionsanalyse.- Vorab zur Wirkungsanalyse.- Diskussion.- 4.2.2 Die linguistische Vielfalt der Wissenschaften.- 4.2.3 Gesetze im Recht, in der Naturwissenschaft und in den Sozialwissenschaften.- 4.2.4 Die Wahrnehmung von Risiken.- 4.2.4.1 Die Wahrnehmung der Juristen.- Der juristische Risikobegriff — unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzrechts.- Risikovorsorge in Bodenschutz.- Gefahr und Risiko in anderen umweltmedialen Bereichen.- Der Risikobegriff de lege ferenda.- 4.2.4.2 Die Wahrnehmung der Naturwissenschaftler.- Risko-Bewertungs-Systeme im Umweltschutz unter den Bedingungen globalisierter Märkte.- Naturwissenschaftliche Definition von „Gefahr“ und „Risiko“.- Naturwissenschaftliche Risikobewertung.- Erstellung von toxikologischen Grenz- und Richtwerten.- 4.2.4.3 Die Wahrnehmung der Ökonomen.- Ursachen des Markt- und Politikversagens.- Ausgangslage.- Von der neoklassischen Umweltökonomie zur transdisziplinären ökologischen Ökonomie.- Grundlagen der neoklassischen Gleichgewichtstheorie.- Grundlagen der neoklassischen Umweltökonomie.- Theorie der meritorischen Güter.- Zwischenfazit: Staatlicher Bodenschutz als ökonomische Notwendigkeit.- Grundlagen der ökologischen Ökonomie.- Politik- bzw. Staatsversagen.- Traditionelle Erklärung des Staatsversagens.- Staats versagen aus sozioökonomischer Sicht.- Ursachen des Staatsversagens aus der Sicht von Landesparlamentariern.- Fazit.- Diskussion.- 4.2.4.4 Die Wahrnehmung der Psychologen.- 4.2.4.5 Die Wahrnehmung der Soziologen: Zur Analyse von Risiken.- 4.2.4.5.1 Risiken in der Sicht der Modernisierungstheorie.- 4.2.4.5.2 Aus der sozialwissenschaftlichen Diskussion.- 4.2.4.5.2.1 Die „gesellschaftlich tolerierte Normalvergiftung“.- 4.2.4.5.2.2 Fehlender Handlungsbedarf?.- 4.2.4.5.3 Risiken in der Sicht der empirischen Soziologie.- 4.2.4.5.4 Risiken in der Sicht des Konstruktivismus.- 4.3 Der Begriff „Risiko“.- 4.3.1 Risiko im allgemeinen.- 4.3.2 Risiko im umweltpolitischen Diskurs.- 4.3.2.1 Unsicherheit im Risiko-Begriff.- 4.3.2.2 Die Bewältigung der Ungewißheit durch die Naturwissenschaften.- 4.3.2.3 Die Bewältigung der Ungewißheit durch die Rechtswissenschaften….- 4.3.2.4 Die Bewältigung der Ungewißheit durch die Sozialwissenschaften…..- 4.4 Das Verhältnis der Risikobegriffe zueinander.- 4.4.1 Sozialwissenschaftlicher Konstruktivismus.- 4.4.2 Naturwissenschaftlicher Konstruktivismus.- 4.4.3 Juristischer Konstruktivismus.- 4.4.4 Komparativer Konstruktivismus.- 4.4.4.1 Integrativer Konstruktivismus.- 4.4.4.2 Postmoderner Konstruktivismus.- 4.4.4.3 Praktischer Konstruktivismus im Bodenschutz.- 4.4.5 Die Bewertung von Risiken in untergesetzlichen Regelwerken.- Typische Muster der weltweiten Bodengefährdung.- Problemanalyse.- Ursachenanalyse.- Musteranalyse.- Akteursanalyse.- Politikoptionen.- Rechtsoptionen.- Diskussion.- 5. Interdisziplinarität.- 5.1 Das gemeinsame Verständnis der Aufgabe.- 5.1.1 Codisziplinäre Beziehungen: Der inhaltliche Aspekt.- 5.1.2 Hindernisse: Der linguistische Aspekt, oder: Wie man Mißverständnisse vermeiden kann.- 5.1.3 Zum Stand der interdisziplinären Zusammenarbeit.- 5.2 Die Beobachtung der Akteure.- 5.2.1 Zusammenarbeit an einem Risiko-Bewertungs-System.- 5.2.2 Anwendung von Risiko-Bewertungs-Systemen.- 5.2.3 Positionsbestimmungen.- 5.2.4 Kautelen.- 5.2.5 Gesellschaftliche und soziale Probleme.- Kultur- und gendersoziologische Anmerkungen.- Ebenen der Analyse von Handlungsspielräumen unter den Geschlechtern.- Diskussion.- 5.2.6 Wirksamkeit von Maßnahmen.- Zur Begrenztheit gesetzlicher Regelungen.- Diskussion.- Von Verläufen und Veränderungen — ein neues Paradigma ist notwendig und möglich.- Wie läßt sich diese strategische Konzeption in die Praxis umsetzen?.- Arbeitsschritte.- Von Belastungsgrenzen zur ökologischen Vorsorge: Sozialwissenschaftliche Perspektiven eines nachhaltigen Umgangs mit Böden.- Grenzen natur- und technikwissenschaftlicher Rationalität.- Grenzwerte als adäquates Instrument der Gefahrenabwehr.- Die Grenzen der Grenzwerte: Von der Bodenreparatur zur Bodenvorsorge.- 6. Anwendung auf andere Rechtssysteme.- 6.1 Rahmenbedingungen eines Transfers.- 6.2 Restriktionen eines Transfers.- 6.3 Kulturwissenschaftliche Untersuchungen.- 6.3.1 Diskussion der kulturellen Bedingungen eines Transfers.- 6.3.2 Empirische Ermittlungen der kulturellen Bedingungen eines Transfers.- 6.4 Konkretisierung eines möglichen Untersuchungsthemas.- 6.4.1 Kinderspielplätze als Testgebiete für den Bodenschutz.- 6.4.2 Weitere Anregungen.- Bemerkungen zur Generalaussprache.- Generalaussprache.- Diskussionserträge.- Ergebnisse im Überblick.- Generelle Fragen.- Akteure.- Akteursverhältnis.- Räumlicher Bezug.- Handlungstheoretische Ebene.- Handlungsorientierung.- Beteiligung.- Ansätze und Theorien.- Gesellschaftsverständnis.- Naturverständnis.- Schutzgut.- Grenzwert.- Gefahr/Risiko/Schaden.- Wissen und Nichtwissen.- Wissensebene.- Interdisziplinarität/Selbstverständnis.- Aufgaben der Naturwissenschaft.- Aufgaben der Sozialwissenschaft.- Transfer.- Konzepte.- Offene Fragen.- Wirkungszusammenhang Gesellschaft — Umwelt.- Handlungsformen und -ebenen.- Ideologie.- Ziele.- Demokratie.- Thematisierung von Umweltproblemen.- Vermittlung.- Intervention und Verhaltensänderung.- Lokale Frage.- Generalisierungsproblem.- Wirkungsforschung (Gesetze und Regelwerke).- 7. Literaturnachweis.- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren.