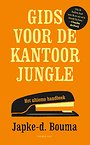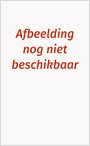1. Die Krise der Führungspsychologie.- 1.1. Überblick.- 1.2. Führung als widersprüchliches Konzept.- 1.2.1. Bestandsaufnahme.- 1.2.2. Kritik.- 1.2.3. Alternativen.- 1.3. Führung als atheoretisch-funktionale Kategorie.- 1.3.1. Bestandsaufnahme.- 1.3.2. Kritik.- 1.3.3. Alternativen.- 1.4. Führung und das Problem des Theorienpluralismus.- 1.4.1. Bestandsaufnahme.- 1.4.2. Kritik.- 1.4.3. Alternativen.- 1.5. Führung und Operationalisierungsbarrieren.- 1.5.1. Bestandsaufnahme.- 1.5.1.1. Die Untersuchung von NACHREINER (1978).- 1.5.1.2. Die Untersuchung von ALLERBECK (1977).- 1.5.1.3. Resümee.- 1.5.2. Kritik.- 1.5.2.1. Psychometrische Qualität der Meßinstrumente.- 1.5.2.2. Zur Problematik der Mittelwertbildung.- 1.5.2.3. Beschreibung vs. Bewertung.- 1.5.2.4. Objektivität vs. Subjektivität.- 1.5.2.5. Die Kritik von LORD (1985).- 1.5.3. Alternativen.- 1.6. Zusammenfassung und Schlußfolgerung.- 2. Der organisationstheoretische Rahmen.- 2.1. Organisationsmetaphern.- 2.2. Das Organisationsmodell von WEICK (1985).- 2.2.1. Definition des “Organisierens”.- 2.2.2. Die Organisation als Fluß und Wandel.- 2.2.2.1. Der Erlebensstrom.- 2.2.2.2. Der Prozeß.- 2.2.3. Die Organisation als kybernetisches System.- 2.2.3.1. Der doppelte Interakt.- 2.2.3.2. Die wechselseitige Äquivalenzstruktur.- 2.2.3.3. Partieller Einschluß.- 2.2.3.4. Kausalschleifen.- 2.2.3.5. Lose Kopplung.- 2.2.4. Die Organisation als Organismus.- 2.2.4.1. Rezepte.- 2.2.4.2. Die Ursachenkarte.- 2.2.4.3. Organisieren als evolutionärer Zyklus.- 3. Die individuelle Ebene des Organisierens: Ursachenkarten und Attributionsprozesse.- 3.1. Die Ursachenkarte.- 3.2. Die klassische Attributionsforschung.- 3.2.1. Das Modell der naiven Handlungsanalyse (HEIDER, 1958).- 3.2.2. Das Modell korrespondierender Inferenzen (JONES u. DAVIS, 1965).- 3.2.3. Anova-Modell und kausale Schemata (KELLEY, 1976).- 3.2.3.1. Kovariationskonzepte und kognitive Varianzanalyse.- 3.2.3.2. Konfigurationskonzepte und kausale Schemata.- 3.2.4. Das Modell der Leistungsattribution (WEINER u.a., 1972).- 3.2.4.1. Schematische Attribution von Erfolg und Mißerfolg.- 3.2.4.2. Attributionstheoretische Reformulierung der Leistungsmotivation.- 3.2.5. Attributionsfehler.- 3.2.5.1. Der falsche Konsensus-Effekt.- 3.2.5.2. Der fundamentale Attributionsfehler.- 3.2.5.3. Perzeptionsdivergenz zwischen Handelnden und Beobachtern.- 3.3. Führungsthematische Implikationen der Attributionsforschung.- 3.3.1. Das Modell von KELLEY (1967).- 3.3.2. Das Modell von WEINER u.a. (1972).- 3.3.3. Attributionsfehler.- 3.4. Attributionsmodelle der Führung.- 3.4.1. Das Modell von CALDER (1977).- 3.4.1.1. Die naive Psychologie der Führung.- 3.4.1.2. Das Prozeßmodell der Informationsverarbeitung.- 3.4.1.3. Kritik.- 3.4.2. Das Modell von GREEN u. MITCHELL (1979).- 3.4.2.1. Modellvorstellungen.- 3.4.2.2. Operationalisierung und Methodik.- 3.4.2.3. Empirische Ergebnisse.- 3.4.2.4. Kritik.- 3.4.2.5. Fazit.- 3.4.3. Das Modell von MÜLLER (1981).- 3.4.3.1. Abkehr vom Bedürfniskonzept.- 3.4.3.2. Der Mensch auf der Suche nach Identität.- 3.4.3.3. Führung und Identität.- 3.4.3.4. Empirische Untersuchung.- 3.4.3.5. Kritik.- 3.5. Die individuelle Perspektive: Resümee.- 4. Die interpersonelle Ebene des Organisierens: Doppelte Interakte, Äquivalenzstrukturen und dyadische Austauschbeziehungen.- 4.1. Der doppelte Interakt.- 4.2. Äquivalenzstrukturen.- 4.3. Dyadischer Austausch: Das Modell von GRAEN (1976).- 4.3.1. Modellvorstellungen.- 4.3.1.1. Aushandlung von Rollen-Definitionen.- 4.3.1.2. Das Vertical-Dyad-Linkage-(VDL)-Modell.- 4.3.1.3. Weiterentwicklungen des VDL-Modells.- 4.3.2. Operationalisierung und Methodik.- 4.3.3. Ergebnisse.- 4.3.4. Kritik.- 4.3.4.1. Kritik am Modell.- 4.3.4.2. Kritik an Operationalisierung und Methodik.- 4.3.5. Fazit.- 4.4. Dyadische Attributionen.- 4.4.1. Das Modell von LISPER (1984).- 4.4.2. Das Modell von WEINER u.a. (1972) im dyadischen Kontext.- 4.4.3. Attributionskonflikte.- 4.4.3.1. Attribution im Kontext von Kommunikation und Beurteilung.- 4.4.3.2. Definition und Einordnung von Attributionskonflikten.- 4.4.3.3. Ausgang von Attributionskonflikten.- 4.5. Die interpersonelle Ebene des Organisierens: Resümee.- 5. Die strukturelle Ebene des Organisierens: Montageregeln für soziales Etikettieren, Attribuieren und Handeln.- 5.1. WEICKs (1985) Konzept der Montageregeln.- 5.2. Zum Begriff der sozialen Regel.- 5.2.1. Der Regelbegriff in der analytischen Sprachphilosophie.- 5.2.2. Das Regelkonzept des Symbolischen Interaktionismus.- 5.2.2.1. Das Basisprogramm der “reflexiven Soziologie”.- 5.2.2.2. Regelsysteme und -typologien.- 5.2.2.3. Regelgenese.- 5.2.3. Soziale Regeln in Organisationen.- 5.3. Leistungsregulation in Wirtschaftsorganisationen.- 5.4. Soziale Muster der Verantwortungsregulation.- 5.4.1. Attribution von Verantwortlichkeit.- 5.4.2. Sanktionen: Lob und Tadel.- 5.4.3. Selbstdarstellung.- 5.4.4. Erklärende Stellungnahmen (“accounts”).- 5.4.5. Selbstdarstellung bei Erfolg und Mißerfolg.- 5.5. Attribution im Kontext von Macht und Beziehungsqualität.- 5.6. Ein Regelmodell für soziales Etikettieren, Attribuieren und Handeln.- 5.6.1. Montageregeln für soziales Etikettieren.- 5.6.1.1. Etikettierungsregeln für Erfolgs-/Mißerfolgssituationen.- 5.6.1.2. Etikettierungsregeln für “IN-Group”/“OUT-Group”-Situationen.- 5.6.1.3. Eigenschaften von Etikettierungsregeln.- 5.6.2. Montageregeln für soziales Attribuieren.- 5.6.2.1. Attribuierungsregeln für Erfolg.- 5.6.2.2. Attribuierungsregeln für Mißerfolg.- 5.6.3. Montageregeln für soziales Handeln.- 5.6.3.1. Handlungsregeln im Falle des Erfolgs.- 5.6.3.2. Handlungsregeln im Falle des Mißerfolgs.- 5.6.4. Regulation von Attributionskonflikten in “IN-Group” und “OUT-Group”.- 5.7. Die strukturelle Perspektive: Resümee.- 6. Zusammenfassung.- 7. Anhang.- 8. Literaturverzeichnis.