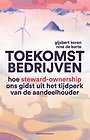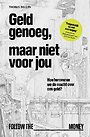1. Einleitung.- 2. Vorbedingungen, Voraussetzungen, besondere Erscheinungsformen und Determinanten aggressiv-gewalttätiger Verhaltenstendenzen.- 2.1 Definitorische Eingrenzung relevanter Begrifflichkeiten.- 2.1.1 Etymologische Herleitungen.- 2.1.2 Versuch einer terminologischen Präzisierung.- 2.2 Biologische Faktoren.- 2.2.1 Psychophysiologische Regulationssysteme.- 2.2.2 Genetik und Chromosomenaberrationen.- 2.2.3 Endokrinologische Bedingtheiten.- 2.3 Die psychologischen Aggressionstheorien.- 2.3.1 Trieb- und instinkttheoretische Modelle.- 2.3.2 Die Frustrations-Aggressions-Hypothese.- 2.3.3 Lerntheoretische Ansätze.- 2.4 Weitere Bedingungsfaktoren.- 2.4.1 Einfluß und Wirkung medialer Gewaltdarstellungen.- 2.4.2 Zum Begriff der Psychopathie.- 2.5 Spezielle Erscheinungsformen.- 2.5.1 Gewalt gegen Randgruppen.- 2.5.2 Mobbing: Aggressionen am Arbeitsplatz.- 2.6 Makrostrukturell-gesamtgesellschaftliche Konstellationen.- 2.6.1 Individualisierung und Modernisierung: Licht- und Schattenseiten.- 2.6.2 Das Selbstverwirklichungsideal einer humanistischen Psychologie.- 2.6.3 Durchsetzung und Konkurrenz in der „Ellenbogengesellschaft“.- 2.6.4 Epiphänomen eines modernen Sozialsystems ?.- 2.7 Zusammenfassung und Fazit.- 3. Aggresssion und Gewalt im Kontext der allgemeinen Bildungsinstitution Schule.- 3.1 Problemexploration.- 3.2 Die Entwicklung eines aktuellen Phänomens.- 3.2.1 Gewalt an Schulen: Eine internationale Herausforderung.- 3.2.1.1 Ergebnisse aus Japan.- 3.2.1.2 Die Vereinigten Staaten.- 3.2.1.3 Skandinavische Länder.- 3.2.2 Aggressive Schülerhandlungen in bundesdeutschen Lehranstalten.- 3.3 Dramatisierung oder Bagatellisierung ?.- 3.3.1 Medienrezeption der neuen Gewalterscheinungen.- 3.3.2 Die schuladministrative Sichtweise.- 3.4 Ausmaß und Verbreitung von Gewalt an Bildungseinrichtungen.- 3.4.1 Offizielle Belastungsfrequenzstatistiken.- 3.4.2 Die Expertise der Gewaltkommission.- 3.4.3 Eine Übersicht zum gegenwärtigen Erkenntnisstand.- 3.4.4 Differenzierung der Forschungsperspektiven.- 3.4.4.1 Sichtweisen Betroffener.- 3.4.4.2 Unterschiedliche Erscheinungsformen.- 3.4.4.3 Das Spektrum der Normabweichungen.- 3.4.4.4 Alters- und Jahrgangsstufen.- 3.4.4.5 Geschlechtsspezifische Besonderheiten.- 3.4.4.6 Schulformen und Gewaltbelastung.- 3.4.4.7 Risikolokalitäten.- 3.5 Zusammenfassende Beurteilung.- 4. Zur Diagnostik der Aggressivität.- 4.1 Methodische Zugänge zur Erfassung psychologisch relevanter Gegebenheiten.- 4.1.1 Einteilungsgesichtspunkte von Erhebungsmethoden.- 4.1.2 Eine Taxonomie situativer Bedingungen.- 4.1.3 „Projektive“ Techniken als indirekte Herangehensweisen.- 4.1.4 Die Fragebogenverfahren in der offenen Situation.- 4.2 Grundlagen des methodenpluralistischen Vorgehens.- 4.2.1 Zum Stellenwert eines unorthodoxen Ansatzes.- 4.2.2 Kennzeichnende Merkmale der multimethodalen Informationsgewinnung.- 4.2.3 Der Bezug zu einer holistisch-integrativen Rahmenkonzeption.- 4.3 Individuenbezogene Informationsgewinnung und psychologische Urteilsbildung.- 4.3.1 Ein Phasen- und Prozeßmodell für die Praxis.- 4.3.2 Das Konvergenz-Divergenz-Prinzip in der Einzelfallarbeit.- 4.4 Die Suche nach geeigneten Erhebungsinstrumenten.- 4.4.1 Allgemeine Vorüberlegungen.- 4.4.2 Die Operationalisierung aggressiver Verhaltenstendenzen.- 4.5 Fazit und Ausblick.- 5. Zusammenfassung.- 6. Literatur.