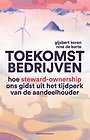Grundfragen der Organisation
Delegation, Anreiz und Kontrolle
Samenvatting
Die Delegation von Entscheidungen und die damit eng verbundenen Fragen der Schaffung von Anreiz-und Kontrollsystemen zahlen zu den Grundfragen einer jeden Organisation. In dem vorliegenden Buch wird untersucht, wie das entscheidungstheo retische Instrumentarium,zur Losung dieser Probleme eingesetzt werden kann. Dabei wird durchgangig auf einer Konzeption aufgebaut, die in meinem Buch "Der Einsatz von Entscheidungsgrernien" vorgestellt und flir den Fall des Einsatzes von Gremien ausftihrlich diskutiert worden ist. Wiihrend dort teilweise recht spezielle Problem stellungen behandelt worden sind, solI in dem vorliegenden Buch die entwickelte Konzeption auf einen relativ weiten Bereich von Anwendungsmoglichkeiten iiber tragen werden. Dabei werden neben Problemen des Anreizes und der Kontrolle vor allem auch zusiitzliche Fiihrungsstile, wie etwa die Delegation an einzelne Entschei dungstrager und der Einsatz von Staben betrachtet. Zugleich wird untersucht, unter welchen Bedingungen die einzelnen Fiihrungsstile aus der Sicht der delegierenden Instanz vorteilhaft sind. Gro~ ist der Kreis jener, ohne deren Unterstiitzung und Rat das Buch in seiner vorliegenden Fassung nicht zustandegekommen ware. Zunachst mochte ich den Herren Wiprecht Brodersen, Giinter Franke, Erich Frese und Dieter Ordelheide flir ihre eingehende und wertvolle Kritik danken. Auch meine Mitarbeiter am Frankfur ter Lehrstuhl flir Organisationstheorie haben durch ihre gro~e Diskussionsbereit schaft wesentlich zum Entstehen des Buches beigetragen. Vor aHem danke ich den Herren Hans-Paul Kaus, Felix Liermann, Joachim Manke und Richard Winter. Herr Michael Horst hat die Zeichnungen angefertigt; Frau Luise Wagner hat mit gro~er Geduld die zahlreichen Fassungen des Manuskripts getippt. Auch hierflir danke ich herzlich.
Specificaties
Inhoudsopgave
Anderen die dit kochten, kochten ook
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht