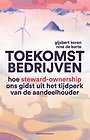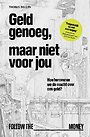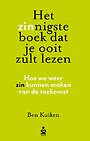Erster Teil. Physikalische und chemische Zahlentafeln.- 1. Einheiten (Kurzzeichen) DIN 1301.- 2. Erläuterungen technischer Bezeichnungen.- 3. Maßsysteme verschiedener Länder.- 4. Atomgewichte.- 5. Spezifisches Gewicht und Volumen des Wassers bei verschiedenen Temperaturen.- 6. Sättigungsdruck des Wasserdampfes.- 7. Zustandsgrößen des gesättigten Wasserdampfes.- 8. Spezifisches Gewicht des überhitzten Wasserdampfes.- 9. Wärmeinhalt des überhitzten Wasserdampfes.- 10. Dampf speicherung.- 11. Normkubikmetergewicht von Gasen und Dämpfen.- 12. Raumgewicht von Luft.- 13. Mittlere spezifische Wärme von Gasen und Dämpfen in kcal/Nm3 °C bei verschiedenen Temperaturen und konstantem Druck.- 14. Mittlere spezifische Wärme von Gasen und Dämpfen in kcal/kg °C bei verschiedenen Temperaturen und konstantem Druck.- 15. Wärmeinhalt von Gasen und Dämpfen in kcal/Nm3 bei verschiedenen Temperaturen und konstantem Druck.- 16. Wärmeinhalt von Gasen und Dämpfen in kcal/kg bei verschiedenen Temperaturen und konstantem Druck.- 17. Oberer und unterer Heizwert verschiedener Stoffe.- 18. Hilfstafeln zur Berechnung des Heizwertes von Brenngasen:.- a) Wasserstoff.- b) Kohlenoxyd.- c) Methan.- d) Schwere Kohlenwasserstoffe.- Zweiter Teil. Meßtechnik.- I. Mengenmessung:.- 1. Berechnung von Blenden.- a) Berechnungsbeispiel für Luft.- b) Berechnungsbeispiel für gereinigtes Generatorgas aus Anthrazit.- c) Berechnungsbeispiel für Dampf.- d) Berechnungsbeispiel für Wasser.- 2. Ausführung der Blenden:.- a) Allgemeines.- b) Ausführung der Blende.- c) Einbau der Blende.- d) Verbindung von Blende und Meßgerät.- 3. Anzeigegeräte.- 4. Geräte mit fortlaufender Aufzeichnung.- II. Temperaturmessung:.- 1. Siede- bzw. Schmelzpunkte verschiedener Stoffe.- 2. Geräte für Temperaturmessung:.- a) Flüssigkeitsthermometer.- b) Flüssigkeits-Federthermometer.- c) Dehnungsthermometer.- d) Elektrische Widerstandsthermometer.- e) Thermoelemente und Durchflußpyrometer.- f) Temperaturschätzung nach der Glühfarbe.- g) Gesamtstrahlungspyrometer.- h) Teilstrahlungspyrometer.- i) Segerkegel.- Dritter Teil. Eigenschaften der Brennstoffe des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- 1. Allgemeine Einteilung der Steinkohlenarten nach dem Verhalten bei der Verkokung.- 2. Kennzeichnung und Vorkommen der deutschen Steinkohlenarten.- 3. Einteilung der Steinkohlenarten des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues nach dem Qehalt an flüchtigen Bestandteilen.- 4. Schematische Darstellung einer Steinkohlenaufbereitungsanlage.- 5. Mittlere Körnungen der Brennstoffe des Ruhr- und Aachener Reviers.- 6. Mittlere Körnungen der Saarbrennstoffe.- 7. Mittlere Asche- und Wassergehalte derRuhr- undAachener Brennstoffe.- 8. Mittlere Asche- und Wassergehalte der Saarbrennstoffe..- 9. Untere Heizwerte der Ruhr- und Aachener Kohlen in Abhängigkeit von ihrem Qehalt an flüchtigen Bestandteilen bezogen auf Reinkohle.- 10. Untere Heizwerte der Reinkohlen (asche- und wasserfreie Substanz) der Brennstoffe des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues in Abhängigkeit von ihrem Qehalt an flüchtigen Bestandteilen.- 11. Errechnung des Heizwertes der Rohkohlen (asche- und wasserhaltige Substanz).- 12. Untere Heizwerte der wichtigsten Brennstoffe des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- 13. Abhängigkeit der Gehalte an Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und disponiblem Wasserstoff der Ruhr- und Aachener Kohlen von ihrem Qehalt an flüchtigen Bestandteilen bezogen auf Reinkohle.- 14. Chemische Zusammensetzung der Brennstoffe des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues bezogen auf Reinkohle.- 15. Normblätter über die Prüfung fester Brennstoffe.- 16. Lagerung von Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues:.- a) Allgemeines.- b) Durchführung der Lagerung.- c) Lagerung im Freien.- d) Silo- und Bunkerlagerung.- Vierter Teil. Verbrennung von Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- 1. Luftbedarf, Abgasmenge, Abgaszusammensetzung und Verbrennungstemperatur.- 2. Ermittlung der Luftüberschußzahl bei vollkommener Verbrennung.- 3. Verluste durch fühlbare Wärme der Abgase.- 4. Verluste durch unvollkommene Verbrennung.- 5. Verluste durch Brennbares in den Rückständen.- 6. Verluste durch Strahlung und Leitung.- 7. Beispiel zur Ermittlung des Wärmehaushaltes aus einem Verdampfungsversuch.- Fünfter Teil. Betrieb von Dampfkesselfeuerungen mit Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- I. Allgemeines über Rostfeuerungen:.- 1. Schema der wichtigsten Feuerungssysteme für Steinkohlen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- 2. Schichthöhen auf dem Rost.- 3. Regelung der Verbrennungsluft.- 4. Roststab-Ausbildung.- 5. Werkstoffe für Roststäbe.- 6. Rostkühlung.- 7. Verhältnis von Rostfläche zu Heizfläche.- II. Planrostfeuerungen:.- 1. Feuerbeschickung.- 2. Bearbeitung des Feuers.- 3. Abschlacken.- 4. Höchste Dauerleistungen bei Planrosten.- 5. Ergebnisse von Verdampfungsversuchen mit Brennstoffen des Ruhr- und Aachener Bergbaues an Dampfkesseln mit Planrostfeuerungen 156/.- III. Wanderrostfeuerungen:.- 1. Ausführung von Wanderrostfeuerungen.- 2. Betrieb von Wanderrosten.- 3. Höchste Dauerleistungen bei Wanderrosten.- 4. Ergebnisse von Verdampfungsversuchen mit Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues an Dampfkesselanlagen mit Wanderrostfeuerungen 164/.- IV. Kohlenstaubfeuerungen:.- 1. Aufbereitung des Kohlenstaubes, Mahlfeinheit.- 2. Verbrennung des Kohlenstaubes.- 3. Richtlinien für den Bau und Betrieb von Kohlenstaubanlagen.- 4. Ergebnisse von Verdampfungsversuchen mit Brennstoffen des Ruhrbergbaues an Dampfkesselanlagen mit Staubfeuerung 166/.- V. Zugerzeugung:.- 1. Natürlicher Zug durch Schornsteine.- 2. Künstlicher Zug durch Saugzugventilatoren.- Sechster Teil. Entgasung von Kohlen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- I. Kohlenauswahl:.- 1. Allgemeines.- 2. Mischen und Mahlen.- 3. Schüttgewicht der Kohle in der Ofenkammer.- II Kokserzeugung:.- 1. Kokskörnungen und -bezeichnungen.- 2. Aschegehalt des Kokses in Abhängigkeit vom Gehalt der Steinkohle an flüchtigen Bestandteilen für verschiedene Aschegehalte der Steinkohle.- 3. Koks-Festigkeitsprüfungen.- 4. Koks-Festigkeit:.- a) Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes der eingesetzten Kohle.- b) Einfluß der Körnung der Kohle.- c) Einfluß der Kammerbreite und Verkokungstemperatur.- d) Einfluß der Kohlenmischung.- III. Gaserzeugung:.- 1. Gasausbeute, Gasheizwert und Gaswertzahl.- 2. Einfluß der Ofentemperatur auf Ausbeute, Heizwert und Zusammensetzung des Gases.- 3. Mischgas, Streckgas.- 4. Gasausbeuten bei Entgasung von Ruhr-, Aachener und Saarkohlen.- 5. Richtlinien für die Gasbeschaffenheit.- 6. Übliche Gas-Heizwerte im Ausland.- 7. Mittlere Zusammensetzung, spezifisches Gewicht, Heizwert und Luftbedarf technischer Gase.- 8. Umrechnung eines abgelesenen Gasvolumens auf den Normzustand.- 9. Umrechnung eines abgelesenen Gasvolumens auf ein anderes Volumen.- 10. Reduktion des Barometerstandes auf 0°.- 11. Berechnung des Auftriebes von Gasen.- IV. Wärmetechnische Anhaltszahlen für Entgasungsöfen:.- 1. Mittlere spezifische Wärme von Koks.- 2. Wärmeleitzahlen von geschütteten Kohlen und Koks in Abhängigkeit von der Temperatur.- 3. Temperaturanstieg in der Mittelebene einer Kokskammer.- 4. Abhängigkeit der Betriebszeit von der Heizzugtemperatur und der Ofenbreite bei gleicher Koksendtemperatur.- 5. Einfluß der Kammerwandstärke auf die Garungszeit.- 6. Verkokungswärme für 1 kg Trockenkohle bei einer Koksendtemperatur von 950°.- 7. Änderung des Unterfeuerungsaufwandes von Ofenbatterien in Abhängigkeit von der Belastung 207,.- 8. Wärmestrombild eines Stadtgaswerkes.- 9. Ausbeute an Tief- und Hochtemperaturteer aus Steinkohlen bezogen auf Reinkohle.- 10. Verteilung des Stickstoffes der Kohle bei der Entgasung.- Siebenter Teil. Vergasung von Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues.- 1. Für Vergasungszwecke geeignete Brennstoff arten.- 2. Qaserzeugerbauarten:.- a) Festrostgaserzeuger.- b) Rostlose Gaserzeuger mit Windhaube.- c) Drehrostgaserzeuger.- 3. Beschickungsvorrichtungen für Gaserzeuger.- 4. Gebläse für Gaserzeuger.- 5. Regler für Gaserzeuger:.- a) Regler für den Dampfzusatz.- b) Regler für den Gasdruck.- 6. Reinigungsanlagen für Generatorgas:.- a) Trockene Entstaubung.- b) Nasse Qasreinigung.- c) Qasentschwefelung.- 7. Größen der Gaserzeuger.- 8. Normale Gaserzeugerbelastungen.- 9. Schüttung im Rundschachtgaserzeuger.- 10. Wind- und Dampfbedarf, Gasausbeute je kg Kohle.- 11. Beispiele für Zusammensetzung und Heizwert von Generatorgas.- 12. Temperatur, Wasser- und Teergehalt des Gases.- 13. Temperaturabfall strömender Gase in Leitungen und Kanälen.- 14. Berechnung der zur Verbrennung eines Gases theoretisch notwendigen Luftmenge und der Verbrennungsprodukte.- 15. Berechnung des Raumgewichtes von Gasen.- 16. Berechnung der Gasausbeute nach dem Kohlenstoff haushalt.- 17. Beispiel für die Berechnung des Wärmehaushaltes eines Gaserzeugers.- 18. Beispiele für den Wärmehaushalt von Gaserzeugern für verschiedene Brennstoffe.- 19. Betrieb von Gaserzeugern:.- A. Inbetriebnahme von Gaserzeugern.- B. Überwachung und Bedienung der Gaserzeuger:.- a) Allgemeines über Messungen an Gaserzeugern.- b) Druckmessungen.- c) Temperaturmessungen.- d) Untersuchung der Gaszusammensetzung.- e) Bestimmung von Feuchtigkeit und Teer im Gas.- f) Messung der Schichthöhe der einzelnen Zonen im Gaserzeuger.- g) Brennstoffaufgabe.- C. Stillsetzen von Gaserzeugern.- 20. Kraftgas.- 21. Brenner für Generatorgas.- a) Rohgasbrenner.- b) Reingasbrenner.- Achter Teil. Verwendung von Brennstoffen des Ruhr-, Aachener und Saarbergbaues in Industrieöfen.- 1. Wärmeübergangszahlen der Ofenaußenwände.- 2. Wärmeverluste bei verschiedenen Ofeninnnenwandtemperaturen.- 3. Wandverluste über der Herdfläche von Stoß- und Glühöfen.- 4. Wandverluste über der Herdflächenbelastung von Stoß-, Roll- und Glühöfen.- 5. Wärmeinhalte verschiedener Stoffe.- 6. Brennstoffverbrauch von Siemens-Martin-Öfen.- 7. Der Gießereischachtofen:.- A. Stoffmengen.- B. Messungen zur Betriebskontrolle.- C. Fehler im Schmelzbetrieb.- 8. Arbeitstemperaturen in der Eisenindustrie.- 9. Anhaltszahlen für Leistung und Wärmeverbrauch von Glasschmelzöfen.- 10. Brennstoffverbrauch für verschiedene keramische Erzeugnisse.- 11. Temperaturverlauf eines Glattbrandes von Porzellan im 65 m3-Rundofen.- 12. Temperaturverlauf eines Glüh- und eines Glattbrandes von Steingut im Rundofen.- 13. Temperaturverlauf eines Garbrandes von gesinterter feinkeramischer Masse in einem Gastunnelofen.- 14. Temperaturverlauf eines Bleiglasurbrandes in einem Tunnelofen mit indirekter Beheizung.- 15. Wärmehaushalt eines Mendheim-Ofens.- 16. Brennstoffverbrauch von Öfen der Kalkindustrie.- 17. Brennstoffverbrauch von Öfen der Zementindustrie.- 18. Arbeitstemperaturen in der keramischen Industrie.- 19. Arbeitstemperaturen in der Kalk-, Zement- und feuerfesten Industrie.- Neunter Teil. Feuerfeste Baustoffe.- I. Allgemeines über feuerfeste Baustoffe:.- 1. Begriffsbestimmung.- 2. Natürliche feuerfeste Baustoffe.- 3. Künstliche feuerfeste Baustoffe.- a) Schamotte.- b) Quarzschamotte.- c) Silika.- d) Sondererzeugnisse.- f) Mörtel, Stampf- und Anstrichmassen.- II Die Verwendung feuerfester Baustoffe:.- 1. Allgemeines.- 2. Feuerfeste Steine für Koks- und Qasöfen.- 3. Feuerfeste Steine für Gaserzeuger.- 4. Feuerfeste Steine für Dampfkesselfeuerungen.- 5. Feuerfeste Isolierstoffe.- III. Deutsche Normen über feuerfesteBaustoffe.- Zehnter Teil. Schrifttum über Brennstoffchemie, Wärmewirtschaft und Betriebswirtschaft.- 1. Chemie der Brennstoffe.- 2. Feuerungstechnik.- 3. Wärmewirtschaft.- 4. Dampfkesselbetrieb.- 5. Gaserzeugung.- 6. Industrieofenbetrieb.- 7. Meßtechnik, Überwachung, Untersuchungen.- 8. Zeitschriften.- Elfter Teil. Sachverzeichnis.