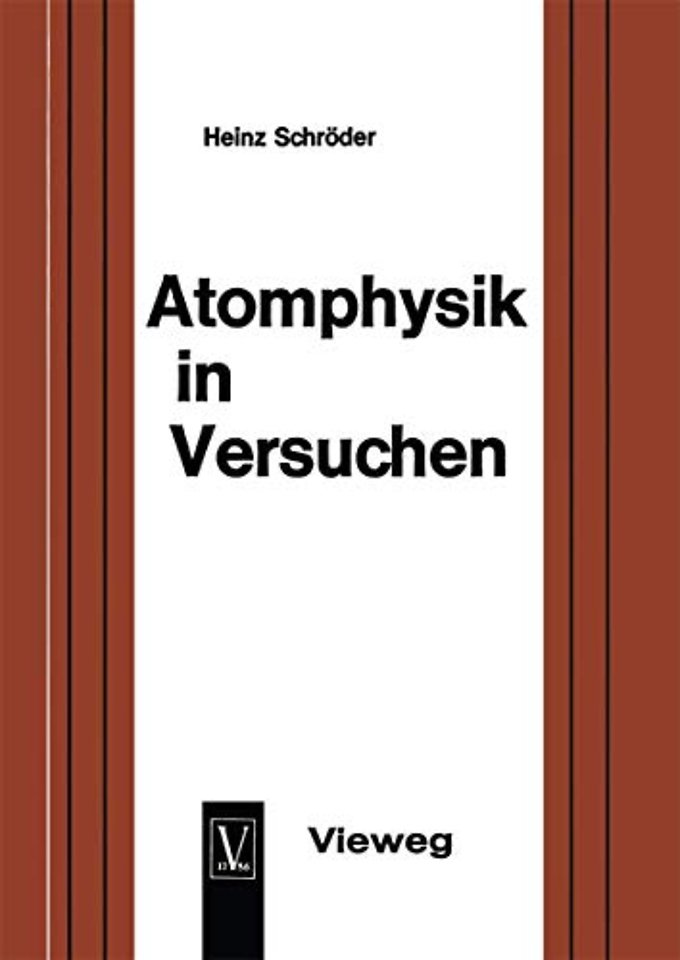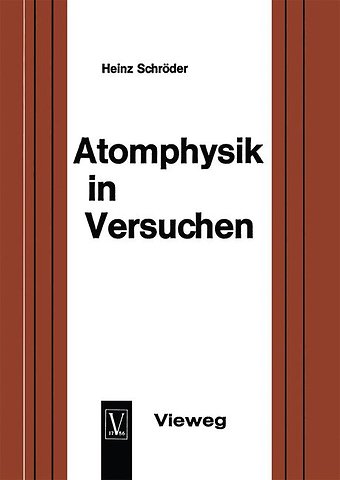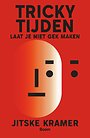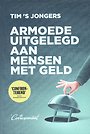Atomphysik in Versuchen
Ein methodischer Leitfaden für den Unterricht
Samenvatting
Der Plan, das vorliegende Buch zu schreiben, wurde im Anschluß an eine Reihe von Kursen gefaßt, die in dem Lehrerfortbildungsheim Rinteln des niedersächsischen Kultusministeriums durchgeführt wur den. Der erste dieser Kurse fand im Jahre 1952 statt. Einer Anregung von Herrn Oberstudiendirektor Möller, Recklinghausen, folgend soll te untersucht werden, inwieweit es möglich ist, die Atomphysik in den Unterricht der höheren Schulen einzuführen. Daß diese Aufgabe zum Thema eines Kurses bestimmt wurde, war damals nicht selbstver ständlich, denn es wurde von berufener Seite nachdrücklich davor ge warnt, daß sich die Schule mehr als beiläufig mit Fragen der Atomphy sik beschäftigt. Diese ablehnende Haltung entsprang der Sorge, daß die Fassungskraft unserer Schüler für eine sachlich einwandfreie Be handlung der neuen Dinge nicht ausreiche und man sich daher mit einer oberflächlichen Durchnahme begnügen müsse, die wertlos oder gar schädlich sei. In dem ohnehin mit Wochenstunden spärlich ausgestatte ten Physikunterricht solle sich - so meinte. man - der Lehrer darauf beschränken, mit seinen Schülern die grundlegenden Erkenntnisse der klassischen Physik sorgfältig zu besprechen. Für die Gründe, mit denen so die neuere Physik fÜr den Unterricht der höheren Schule abgelehnt wurde und vielleicht no,ch wird, war in dem damaligen Kurs volles Verständnis vorhanden. Wie jenen Warnern lag auch den Teilnehmern des Kurses wie mir als seinem Leiter am Her zen, daß ein Physikunterricht gegeben wird, der bildenden Wert hat.
Specificaties
Inhoudsopgave
Anderen die dit kochten, kochten ook
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht